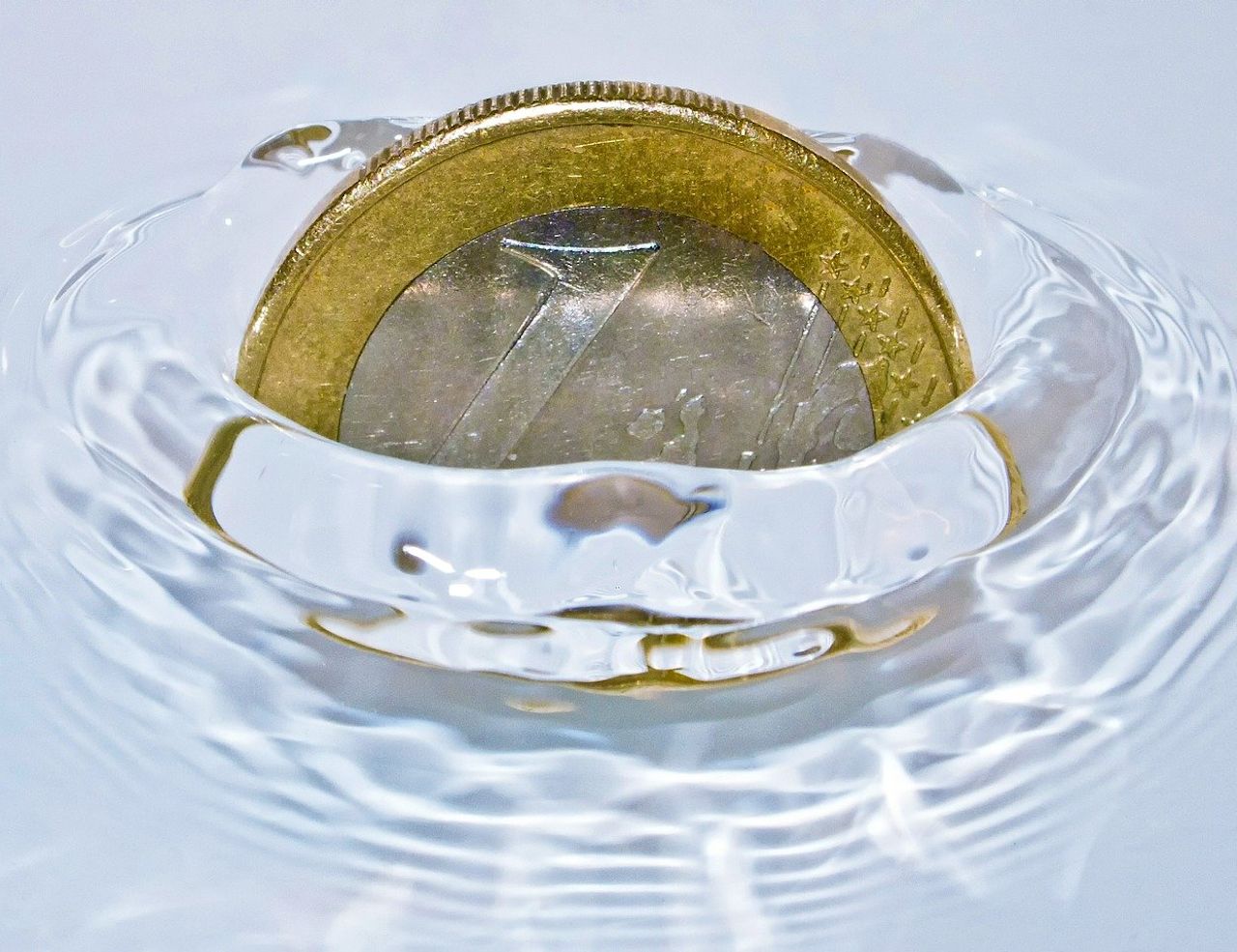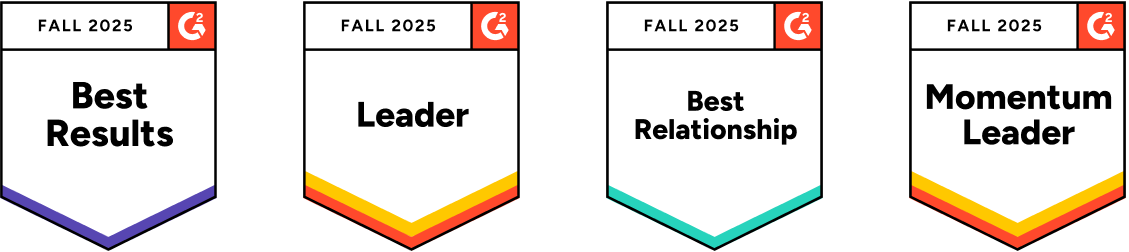Factoring: Definition, Erklärung und Kosten für kleine und mittelständische Unternehmen


Wäre es nicht schön, wenn Sie sich mit Ihrem Unternehmen einfach auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren und den gesamten Rechnungs- und Eintreibungsprozess anderen überlassen könnten? Genau das ist mit Factoring möglich. Wir erklären Ihnen, was das bedeutet und wie Sie einen erheblichen Teil oder sogar das gesamte Debitorenmanagement auslagern und Ihre Mitarbeiter:innen entlasten können.
Definition: Was bedeutet Factoring?
Factoring bezeichnet den Verkauf von Forderungen an ein Factoring-Unternehmen. Für viele Unternehmen ist dieser Vorgang eine Finanzierungsform, die sie vor Liquiditätsengpässen schützt, die entstehen, wenn Debitoren nicht zahlen oder in Verzug geraten.
Sie übergeben als Unternehmer:in oder Finanzverantwortliche:r im Rahmen dieser Finanzdienstleistung also Ihre Rechnungen an einen Dritten und erhalten dafür sofort Liquidität. So müssen Sie dafür nicht auf die Zahlungen Ihrer Kund:innen warten.
Dieser Prozess bietet Ihnen den Vorteil, dass Sie Ihr Geld schneller erhalten und somit Ihre Liquidität verbessern können. Für die Übernahme des Zahlungsausfallrisikos und die sofortige Bereitstellung der Geldmittel berechnet die Factoring-Gesellschaft in der Regel eine Gebühr.

Erklärung: Die Bedeutung von Factoring für Unternehmen
Für Unternehmen kann Factoring vor allem aufgrund zweier Dinge relevant sein: die Steigerung sowohl der finanziellen Flexibilität als auch der Sicherheit. Durch den Verkauf offener Forderungen an eine Factoring-Gesellschaft können Sie ihr Kapital sofort nutzen, anstatt auf die Zahlungsziele Ihrer Kund:innen zu warten.
Diese liegen oft bei 30 Tagen oder länger und -- viel wichtiger -- werden nicht immer eingehalten. Nicht selten vergehen viele Monate, bis Zahlungen getätigt werden. Gerade bei Betrieben mit Großkundschaft können so ausstehende Barmittel zu einem realen Problem werden.
Eine Factoring-Gesellschaft übernimmt zudem das Ausfallrisiko für die verkauften Forderungen, was wiederum Ihr Risiko finanzieller Engpässe durch Zahlungsausfälle reduziert.
Wie funktioniert Factoring in der Praxis?
Factoring funktioniert in der Praxis durch einen verhältnismäßig einfachen Prozess: Ein Unternehmen verkauft seine offenen Forderungen an eine Factoring-Gesellschaft und erhält im Gegenzug den Großteil des Rechnungsbetrags sofort ausgezahlt. Üblicherweise liegt der prozentuale Anteil bei einem Forderungsverkauf zwischen 80 und 90 Prozent.
Die verbleibende Summe, abzüglich der Factoring-Gebühr, wird dem Unternehmen ausgezahlt, sobald der oder die Kund:in die Rechnung beglichen hat.
Stellen Sie sich vor, Sie sind Unternehmer:in im Baustoffhandel. Sie haben immer wieder mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen, da Ihre Kund:innen ihre Rechnungen sehr spät zahlen. Deshalb verkaufen Sie Forderungen im Wert von 100.000 Euro an eine Factoring-Gesellschaft und erhalten dafür sofort 90.000 Euro.
Fünf Monate später wird die Rechnung von Ihrem Kunden bezahlt. Jetzt erhalten Sie in diesem Factoring-Beispiel den restlichen Betrag ausbezahlt -- abzüglich der Gebühren.

Welche Arten von Factoring gibt es?
Factoring ist tatsächlich vielfältig. Passend zu den Bedürfnissen und Gegebenheiten in Ihrem Unternehmen können Sie den Vertrag mit dem Factoring-Unternehmen anpassen, das Debitorenmanagement vollständig oder teilweise abgeben, das Ausfallrisiko dem Dienstleistenden überlassen oder nach wie vor mittragen.
· Echtes Factoring: Das klassische Factoring wird auch echtes Factoring genannt. Der Factor trägt das gesamte Risiko und der Auftraggebende erhält gegen Servicegebühren regelmäßig und zuverlässig sein Geld.
· Unechtes Factoring: Beim unechten Factoring werden die Forderungen verkauft, das Ausfallrisiko verbleibt jedoch beim Unternehmen. Sollte der Debitor Insolvenz anmelden, geht das Unternehmen leer aus.
· Stilles Factoring: Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Kund:innen vom Verkauf der Forderungen wissen, bietet sich das sogenannte stille Factoring an. Dabei werden die Abläufe wie beim echten Factoring abgewickelt -- allerdings Wahrnehmung des Debitors von der dritten Partei.
· Offenes Factoring: Sie können es sich bestimmt schon ableiten: Beim offenen Factoring wird dem Debitoren offen mitgeteilt, dass seine Forderungen an einen Factoring-Dienstleister abgetreten und eingefordert werden.
· Full Factoring: Sie möchten Ihr gesamtes Debitorenmanagement an einen Factor abgeben? Der Eintreibungsprozess soll Ihre Mitarbeiter:innen nicht einmal mehr tangieren? Diese Art von Factoring wird Full Factoring genannt.
· Inhouse Factoring: Vor allem Großunternehmen kooperieren in anteiliger Form mit Factoring-Unternehmen und geben lediglich Teile Ihres Debitorenmanagements an den Dienstleister ab.
· Export Factoring: Natürlich kommt es auch vor, dass ein Debitor seinen Sitz im Ausland hat. Wenn ein Factoring-Unternehmen einen entsprechenden Rechnungsbetrag dieses Debitors eintreibt, wird dieser Vorgang Export Factoring genannt.
· Maturity Factoring: Der Factor übernimmt beim Maturity Factoring das gesamte Debitorenmanagement sowie das Eintreiben der Forderungen. Normalerweise - beim echten Factoring - erfolgt die Auszahlung der Beträge zwei bis drei Werktage nach Zahlungseingang. Beim Maturity Factoring wurde ein Auszahlungsdatum in der Zukunft festgelegt. An diesem Fälligkeitsdatum zahlt das Factoring-Unternehmen die Beträge abzüglich der Servicegebühren.
Gebühren und Kosten von Factoring
Die Gebühren und Kosten von Factoring setzen sich in der Regel aus zwei Hauptkomponenten zusammen:
-
der Factoring-Gebühr
-
den Zinsen für den vorfinanzierten Betrag
Factoring-Gebühren
Die Factoring-Gebühr ist ein Prozentsatz des Rechnungsbetrags, den Sie für den Service des Factorings bezahlen. Diese Gebühr beinhaltet nicht nur die eigentliche Dienstleistung mit Mahnwesen und Debitorenbuchhaltung, sondern auch das Risiko des Forderungsausfalls.
Es gibt hier keine pauschale Gebühr, die überall dieselbe ist. Sie variiert je nach Branche, Volumen der Forderungen, Bonität der Debitoren und der Laufzeit der Forderungen. Als Faustregel liegt Sie meist in einer Spanne zwischen 0,5 und 5 Prozent.
Factoring-Zinsen
Neben der Factoring-Gebühr fallen oft Zinsen für den Zeitraum an, in dem das Geld vorfinanziert wird. Diese Zinsen werden auf den Betrag berechnet, der Ihnen im Voraus ausgezahlt wird. Sie sind vergleichbar mit den Zinsen eines kurzfristigen Kredits, den Sie bei einer Bank beantragen. Das heißt: Die Höhe der Zinsen hängt immer vom aktuellen Zinsniveau und der Bonität Ihres Betriebs ab.
Factoring vs. Bank und Kredite
Bei der Betrachtung der Kosten ist es wichtig, dass Sie die Gesamtkosten des Factorings bewerten und in Relation setzen. Nicht immer ist diese Finanzierungsoption wirtschaftlich die sinnvollste Lösung.
Möglicherweise könnte eine alternative Finanzierungsmöglichkeit wie ein Bankkredit oder eine Kreditlinie günstiger sein. Prüfen Sie zudem die Vertragsbedingungen im Detail. Einige Factoring-Anbieter erheben zusätzliche Gebühren für die Verwaltung, die Kontoeröffnung oder im Falle einer vorzeitiger Beendigung des Vertrags.
Was sind die Vor- und Nachteile von Factoring?
Neben den Kosten gibt es weitere Vor- und Nachteile, die Sie abwägen sollten. In manchen Fällen kann es sich gerade als kleines oder mittelständisches Unternehmen lohnen, auf Factoring zu setzen.
Vorteile von Factoring
Folgende Aspekte sprechen dafür:
· Liquiditätsgewinn: In der Regel überweisen Factoring-Unternehmen 80 bis 90 Prozent des gesamten Forderungsvolumens direkt nach der Bonitätsprüfung des Unternehmens, welches die Forderungen verkauft hat. Dadurch stärken Sie die Eigenkapitalquote
Ihres Unternehmens und können zuverlässig mit den Beträgen aus den Forderungen kalkulieren.
· Risikoabsicherung: Beim klassischen Factoring übernimmt das Factoring-Unternehmen das Risiko für eventuelle Ausfälle. Als Unternehmer:in ergeben sich für Sie nun freie Kapazitäten, die Sie sinnvoll nutzen können.
· Entlastung von Mitarbeiter:innen: Wenn Sie das Debitorenmanagement outsourcen, sparen Sie Kosten für Mitarbeiter:innen, die diese Aufgaben sonst erledigen würden. Diese Mittel können Sie an anderer Stelle sinnvoll für Ihr Unternehmen einsetzen.
· Steigerung der Bonität: Durch Factoring müssen die veräußerten Forderungen nicht mehr in der Unternehmensbilanz aufgelistet werden -- die finanziellen Mittel hingegen stehen dem Unternehmen Mahnwesens und der Debitorenbuchhaltung trotzdem zur Verfügung. Durch die höhere Eigenkapitalquote verbessert sich die Bonität Ihres Unternehmens, wodurch Sie potenziell attraktivere Konditionen bei Krediten und anderen Finanzprodukten erhalten können.
· Einfacher Kundenkontakt: Oft sorgen finanzielle Themen für eine belastete Unternehmen-Debitoren-Beziehung. Durch einen unabhängigen Dienstleister, der den Eintreibungsprozess übernimmt, sind die Forderungen jederzeit gedeckt. Das ermöglicht einen unbelasteten Kundenkontakt mit Fokus auf die relevanten Themen.
Nachteile von Factoring
Neben den Vorteilen gibt es auch einige Nachteile, die Sie Bedenken sollten. Die wichtigsten Factoring-Nachteile im Überblick:
· Nicht für jede Branche geeignet: Leider lohnt es sich nicht für jedes Unternehmen, einen Factoring-Service an Bord zu holen. Vor allem Dienstleister mit projektgebundenen Aufträgen werden seltener angenommen als beispielsweise KMU aus der Industrie oder Großhändler.
· Kosten für das Factoring-Unternehmen: Natürlich erledigen Factoring-Unternehmen diese Aufgabe nicht gratis. Die durchschnittlichen Kosten liegen wie beschrieben zwischen 0,5 und 5 Prozent des Forderungsvolumens. Zusätzlich steht eine regelmäßige Bonitätsprüfung an, die gut 25 Euro pro Debitor ausmacht. Zudem fallen Zinsen an.
· Kosten-Nutzen-Abwägung: Gerade als kleines Unternehmen lohnt es sich, gründlich zu kalkulieren, bevor Sie ein Factoring-Unternehmen ins Boot holen. Wie hoch wäre Ihr durchschnittliches Forderungsvolumen? Wie hoch sind dann die Kosten für das Factoring-Unternehmen? Zudem sollten Sie die Kosten für eine Fachkraft mit den Kosten für ein Factoring-Unternehmen vergleichen. Zahlen lügen schließlich nicht.
Fazit: Factoring ist eine spannende Finanzierungsoption
Nun kennen Sie die verschiedenen Arten von Factoring sowie die Vor- und Nachteile dieses Finanzierungsmodells. Wenn Sie sich sicher sind, welche Leistungen Sie sich von einem entsprechenden Dienstleister wünschen, können Sie nun auf die Suche gehen und mehrere Angebote einholen.
Wichtig für eine Zusammenarbeit mit einem Factoring-Unternehmen ist übrigens nicht nur, dass die Chemie stimmt, sondern auch eine gute Bonität Ihres Unternehmens. Dann sind Probleme mit Finanzforderungen schon bald Geschichte und der Liquiditätsengpass in weite Ferne gerückt.
FAQ: Meistgestellte Fragen zum Thema Factoring
Was versteht man unter Factoring einfach erklärt?
Factoring ist ein Finanzierungsinstrument, bei dem Unternehmen ihre offenen Forderungen an eine Factoring-Gesellschaft verkaufen. Für diesen Forderungsverkauf erhalten sie sofort Geld und dadurch Liquidität, statt auf die Zahlung durch den oder die Kund:in zu warten.
Was bedeutet Factoring?
Factoring bezeichnet den Prozess des Verkaufs von offenen Forderungen aus Warenlieferungen oder Dienstleistungen an einen Factoring-Dienstleister. Dieser zahlt dem Unternehmen im Rahmen des vereinbarten Factoring-Vertrags einen Großteil des Rechnungswertes sofort -- unabhängig von der Zahlungsfrist -- aus und übernimmt das Ausfallrisiko sowie die Verwaltung der Forderungen.
Welche Unternehmen nutzen Factoring?
Factoring wird von Unternehmen verschiedenster Branchen und Größen genutzt -- ob im Handel, der Industrie oder dem Handwerk. Der Grund ist immer, dass der jeweilige Betrieb eine schnelle Umwandlung von Forderungen in Liquidität benötigt oder das Risiko von Zahlungsausfällen reduzieren will. Es eignet sich sowohl für mittelständische Unternehmen als auch für Großkonzerne, die ihre Cashflows optimieren möchten.
Was ist der Unterschied zwischen Inkasso und Factoring?
Inkasso bezieht sich auf das Eintreiben bereits fälliger und unbezahlter Forderungen. Factoring hingegen setzt früher an und bezeichnet den Verkauf noch nicht fälliger Forderungen an ein spezialisiertes Unternehmen. Es ist also eine Finanzierungslösung, während Inkasso ein Prozess des Forderungseinzugs ist.
Welche Voraussetzungen gibt es für Factoring?
Zu den Voraussetzungen für Factoring gehören ein etabliertes Geschäft mit nachweisbaren Umsätzen, rechtlich einwandfreie und durchsetzbare Forderungen sowie die Bonität der Debitoren. Factoring-Gesellschaften führen in der Regel eine Prüfung der Kreditwürdigkeit des Unternehmens und seiner Kund:innen durch, um ihr eigenes Risiko einzuschätzen.
Was bedeutet Reverse Factoring?
Reverse Factoring ist eine Variante des Factorings, bei der der Einkäufer (und nicht der Verkäufer) die Finanzierungslösung initiiert. Dabei arrangiert der Käufer über eine Factoring-Gesellschaft die Bezahlung der Rechnungen seiner Lieferanten vor Fälligkeit. Später begleicht der Käufer die Vorfinanzierung an die Factoring-Gesellschaft. Auf diesem Wege sollen die Lieferantenbeziehungen und Zahlungsbedingungen für die Lieferanten gestärkt werden.
Gibt es auch Factoring ohne Bonitätsprüfung?
Obwohl die Bonitätsprüfung ein wesentlicher Bestandteil des Factoring-Prozesses ist, bieten einige Dienstleister vereinfachte Verfahren oder Produkte für kleinere Unternehmen mit geringeren Forderungsvolumina an. Wichtig: Solche Angebote sind in der Regel deutlich teurer, da das Risiko für die Factoring-Firma höher ist.
Welche Factoring-Gesellschaften gibt es?
Es gibt dutzende Factoring-Gesellschaften in Deutschland und darüber hinaus. Zu den bekanntesten zählen A.B.S. Global, Crefo Factoring, JITpay, Deutsche Factoring Bank, FundFlow, S-Factoring und Wolf Factoring. Wenn Sie auf der Suche nach einem verlässlichen Unternehmen sind, werfen Sie am besten einen Blick auf den Deutschen Factoring Verband e.V. und den Bundesverband Factoring für den Mittelstand. Die meisten deutschen Factorer sind in diesen zwei Gruppen gelistet.
Was gehört in einen Factoring-Vertrag?
Ein Factoring-Vertrag sollte detaillierte Angaben zu den Rahmenbedingungen des Factorings enthalten. Dazu zählen die Höhe der Vorauszahlungen, die Factoring-Gebühren, Zinsen für die Vorfinanzierung, Laufzeit des Vertrages, Umgang mit nicht einbringlichen Forderungen und Kündigungsbedingungen.