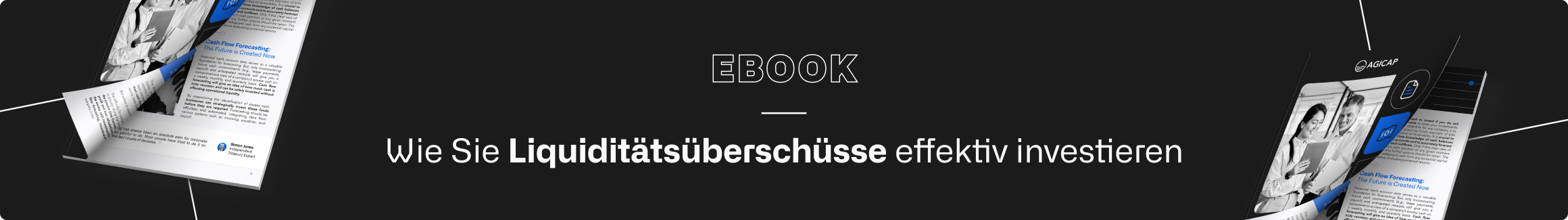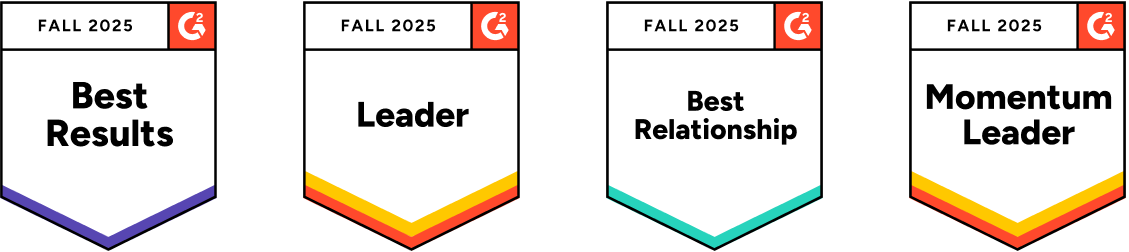Stille Reserven: Definition, Bedeutung, Beispiele


Für die Finanzsituation eines Unternehmens sind auch die sog. stillen Reserven von großer Bedeutung. Sie stärken die Liquidität und werden häufig strategisch eingesetzt. In der Bilanz sind die stillen Reserven nicht zu sehen. Sie werden nicht offen ausgewiesen. Der Gewinn ist also entsprechend niedrig. Das heißt jedoch auch, dass die steuerlichen Belastungen des Unternehmens niedriger sind. Was hat es mit den stillen Reserven nun tatsächlich auf sich? Und warum sind sie für das Liquiditätsmanagement so interessant?
Tipp: Lesen Sie auch unseren Beitrag zu Liquiditätsüberschüssen und wie Sie mit diesen Ihre Rendite steigern.
Definition stille Reserven: Was versteht man unter stille Reserven?
Wie lautet die Definition von stillen Reserven? Stille Reserven sind ein bestimmter Bestandteil des Eigenkapitals. Sie werden nicht offen in der Bilanz ausgewiesen. Das Eigenkapital wirkt also hierdurch niedriger, als es tatsächlich ist.
Manchmal wird in diesem Zusammenhang auch von „versteckten Rücklagen" oder „stillen Rücklagen" gesprochen.
Aber Achtung: Stille Reserven und die Position Rücklagen in der Bilanz dürfen nicht verwechselt werden!
Wo gibt es stille Reserven?
Stille Reserven sind eine Begrifflichkeit aus dem Rechnungswesen. Es handelt sich um einen Betrag, der die Differenz zwischen einem bilanzierten und einem tatsächlichen Wert widerspiegelt.
Die Formel lautet also:
Tatsächlicher Wert abzgl. Buchwert = Stille Reserven
Entstehung von stillen Reserven und stillen Lasten in der Bilanz
Stille Reserven können entstehen, wenn Vermögensgegenstände auf der Aktivseite zu niedrig bewertet oder überhaupt nicht aktiviert werden. Doch auch, wenn auf der Passivseite bestimmte Posten zu hoch bewertet werden, können sog. stille Reserven entstehen. Dies ist beispielsweise bei einer zu hohen Bewertung von Verbindlichkeiten der Fall.
Der umgekehrte Fall wird als „Stille Lasten" bezeichnet. Wenn Vermögensgegenstände auf der Aktivseite zu hoch bewertet werden oder Positionen auf der Passivseite zu niedrig, dann hat das Unternehmen hier „stille Lasten".
Wichtig: In der Bilanz sind stille Reserven also nicht transparent ersichtlich. Die Bilanz informiert über diese Form der Liquiditätsreserve auf den ersten Blick nicht.
Für was bildet man stille Reserven?
Stille Reserven können aus steuertaktischen Gründen gebildet werden, indem Bewertungs- und Gestaltungsspielräume genutzt werden. Sie können jedoch auch zwangsläufig (unabsichtlich) entstehen. Nicht immer sind sich Unternehmen dann überhaupt darüber im Klaren, dass sie stille Reserven haben.
Stille Reserven sind ein beliebtes Mittel, um finanzielle Vorteile auszunutzen und eine hohe Steuerbelastung zu vermeiden. Allerdings muss Unternehmen auch bewusst sein -- gerade im Zusammenhang mit Fremdkapitalgebern -- dass die stillen Reserven in der Bilanz „versteckt" und nicht offen ausgewiesen sind. Von diesen Sicherheiten weiß der potenzielle Kreditgeber dann also nichts. Diese Reserven müssen deshalb erläutert werden.
Stille Reserven: Folgen
Wenn stille Reserven entstehen, hat dies die Konsequenz, dass der Gewinn in der Bilanz niedriger ausgewiesen wird als es der Realität entspricht. Der Gewinn ist jedoch wiederum maßgeblich für die Berechnung der Steuerlast.
Steuerlich wirken sich also stille Reserven zunächst steuermindernd aus. Deshalb nutzen Unternehmen auch häufig diese Form im Bereich von Bewertungs- bzw. Gestaltungsspielräumen aus, um ihre Steuerlast zu verringern. Allerdings werden stille Reserven in bestimmten Fällen auch gewinnerhöhend wieder aufgelöst. Dann erhöht sich auch entsprechend die steuerliche Belastung. Gerade hier können sich Fehler schmerzhaft auf die Unternehmensliquidität auswirken. Deshalb muss mit Bedacht vorgegangen werden.
Wenn bereits klar ist, dass für das kommende Jahr Verluste drohen, kann es strategisch sein, stille Reserven im aktuellen Geschäftsjahr zu bilden, um die Steuerbelastung zu mindern. Wenn diese dann im folgenden Jahr aufgelöst werden, wirkt sich dies auf die Liquidität nicht so belastend aus. Der zu erwartende Verlust wird durch die gewinnerhöhende Auflösung der stillen Reserve verringert -- und das Bilanzergebnis damit ebenfalls verbessert.
Achtung: Bilanzpolitische Maßnahmen sind ein beliebtes Mittel. Doch Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie sich im erlaubten Rahmen bewegen. Steuerberatung ist hier dringend zu empfehlen.
Stille Reserven im Blick behalten
Für das Liquiditätsmanagement ist es wichtig, sich über die Entstehung von stillen Reserven im Klaren zu sein. Genaugenommen handelt es sich um Sicherheiten des Unternehmens, die von einem möglichen Kreditgeber/Investor nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Doch auch die stillen Reserven sind Teil des Firmenvermögens.
Liquiditätsreserven aufzubauen, wirkt sich auf Kreditwürdigkeitsprüfungen günstig aus. Deshalb ist es wichtig, dass Unternehmen hier Transparenz herstellen. Das ist jedoch gar nicht immer so einfach. Und leider gehört es auch zur Realität, dass Unternehmen das eigene Zahlenwerk gar nicht immer so genau kennen -- und Potenziale verschenken.
Reicht ein Unternehmen lediglich den (vorläufigen) Jahresabschluss bei einem Kreditantrag mit ein, ohne den Bankberater auf stille Reserven aufmerksam zu machen, dann kann sich dies negativ auswirken. Finanzierungskosten können erheblich höher ausfallen, wenn eine Bank diese Informationen nicht zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und das wiederum wirkt sich auf die komplette Liquiditätssituation negativ aus.
Merke: Stille Reserven müssen identifiziert werden. Auch das Liquiditätsmanagement muss hier den Überblick bewahren. Nur so können Liquiditätsreserven realistisch ermittelt werden. Eine mögliche Auflösung der stillen Reserven muss in der Liquiditätsplanung bedacht werden. Schließlich kann sich aufgrund der Auflösung eine hohe Steuerzahlung ergeben. Es muss sichergestellt werden, dass für die Zahlung der Steuern ausreichend liquide Mittel vorhanden sind.
Entstehung von stillen Reserven: Verschiedene Arten
Es gibt verschiedene Arten, wie stille Reserven entstehen können. So beispielsweise:
· Das Unternehmen nutzt Bewertungs- und Gestaltungsspielräume aus. Die stillen Reserven werden gebildet und steuerliche Belastungen gemindert.
· Die stillen Reserven entstehen (unabsichtlich) zwangsläufig aufgrund von gesetzlichen Vorschriften. Beispielsweise durch das Vornehmen von Abschreibungen.
· Die stillen Reserven entstehen versehentlich aufgrund von einer falschen Schätzung (zum Beispiel bei der Bildung von Rückstellungen).
· Die stillen Reserven entstehen willkürlich -- das Unternehmen geht „zu großzügig" mit Überbewertungen/Unterbewertungen in der Bilanzierung vor.
Stille Reserven: Anlagevermögen
Stille Reserven entstehen häufig im Zusammenhang mit dem Anlagevermögen. Wenn beispielsweise eine Immobilie des Unternehmens nicht mit dem tatsächlichen Wert, sondern einem niedrigeren Wert, in der Bilanz steht, dann sind hier stille Reserven vorhanden. Es kommt hier also zu einer Unterbewertung von Vermögensgegenständen auf der Aktivseite der Bilanz.
Für den Leser einer Bilanz handelt es sich jedoch um unsichtbare Reserven. Es ist in der Regel nicht klar ersichtlich, dass diese Immobilie nicht mit dem aktuellen Marktwert bilanziert wurde.
Aufdeckung stiller Reserven
Wird der Vermögensgegenstand, durch den stille Reserven entstanden sind, veräußert oder aus dem Unternehmen entnommen, dann kommt es zu einer Aufdeckung der stillen Reserven.
Beispiele für stille Reserven
Es gibt verschiedene Fälle, in denen es zur Bildung stiller Reserven kommt. So beispielsweise Folgende:
· Immobilie: Die Immobilie wird in der Bilanz aktiviert. Doch über die Jahre entwickelt sich der Marktwert positiv. Es kommt zu Wertsteigerungen. Allerdings gibt das Handelsgesetzbuch (HGB) klar vor, dass maximal die Anschaffungskosten (vermindert um Abschreibungen) anzusetzen sind.
· Abschreibung: Ein Unternehmen kauft einen Firmenwagen und nimmt entsprechende Abschreibungen vor (Nutzungsdauer sechs Jahre). Nach acht Jahren steht der Firmenwagen nur noch mit einem Erinnerungswert von einem Euro in der Bilanz. Der Firmenwagen wird für 8.000 Euro verkauft. Die stillen Reserven werden entsprechend aufgelöst. Durch den Erlös wird der Gewinn erhöht.
· Rückstellungen: Ein Unternehmen hat Rückstellungen gebildet. Allerdings kam es zu einer Überbewertung auf der Passiva. Bei der Auflösung der Rückstellung werden auch die stillen Reserven aufgedeckt.
Beispiel: Stille Reserven auflösen und versteuern
Ein Unternehmen hat ein Betriebsgebäude mit 300.000 Euro bilanziert. Der aktuelle Marktwert liegt jedoch bei 600.000 Euro. Das Betriebsgebäude wird für 600.000 Euro verkauft.
Die stillen Reserven berechnen sich wie folgt:
Tatsächlicher Wert 600.000 Euro -- Buchwert 300.000 Euro = 300.000 Euro stille Reserven
Die stillen Reserven in Höhe von 300.000 Euro müssen grundsätzlich gewinnerhöhend aufgelöst werden. Das heißt, die 300.000 Euro erhöhen den Gewinn und werden entsprechend versteuert.
Hinweis: Im Zusammenhang mit stillen Reserven gibt es zahlreiche komplexe Regelungen, beispielsweise im Zusammenhang mit Umstrukturierungen. Durch Fusionen könnte es zur Aufdeckung von stillen Reserven kommen. Die Steuerbelastung wäre in diesem Fall ein großes Hindernis für eine Umstrukturierung. Mögliche Expansionen können dann aufgrund der enormen finanziellen Belastung gar nicht realisiert werden. Dies wollen Unternehmen in der Regel vermeiden. Das Umwandlungssteuerrecht sieht hier beispielsweise Sonderregelungen vor, sodass es nicht zur Aufdeckung von stillen Reserven kommt. Hier werden jedoch strenge Anforderungen gestellt. In diesem Zusammenhang ist Beratung unerlässlich.
Stille Reserven berechnen: Beispiel Abschreibung
Im Anlagevermögen ist ein Bürotisch bereits abgeschrieben worden. In der Bilanz steht der Tisch noch mit einem Erinnerungswert von einem Euro im Anlageverzeichnis. Das Unternehmen ist gesetzlich verpflichtet, Abschreibungen vorzunehmen. Die stillen Reserven sind also zwangsläufig entstanden. Der aktuelle Marktwert des Tisches liegt jedoch nicht bei einem Euro. Das Unternehmen verkauft den Tisch für 200 Euro.
Die stillen Reserven betragen also: 200 Euro abzgl. 1 Euro = 199 Euro.
Wichtig: Die Differenz zwischen dem tatsächlichen Wert und dem bilanzierten Wert ergibt die stillen Reserven.
Beispiel: Buchung stille Reserve
Nimmt man das obige Beispiel mit dem Bürotisch, dann kann wie folgt gebucht werden (aus Vereinfachung ohne Umsatzsteuer):
Schritt 1: Bank 200 Euro an Erlöse aus Anlagenverkauf 200 Euro
Schritt 2: Anlagenabgang Sachanlagen 1 Euro an Büroeinrichtung 1 Euro
Auch bei der Buchung taucht also der Begriff „stille Reserven" nicht auf.
Stille Reserven: Beispiel Passivseite
Auch auf der Passivseite können stille Reserven entstehen. Bei der Bildung von Rückstellungen müssen Unternehmen häufig Schätzungen vornehmen.
Wenn noch nicht genau klar ist, welche Verbindlichkeiten auf ein Unternehmen zukommen, kann es (unabsichtlich) zu einer Überbewertung kommen. Nicht selten schätzen jedoch Unternehmen hier tendenziell etwas zu hoch, um die Steuerbelastung zu mindern.
Fazit: Stille Reserven sind für das Liquiditätsmanagement wichtig
Die Bildung stiller Reserven ist ein bewährtes Mittel von Unternehmen mit dem Ziel einer geringeren Steuerlast. Allerdings entstehen stille Reserven auch häufig unbewusst und unbeabsichtigt.
Dies zeigt einmal mehr, wie wichtig es für das Liquiditätsmanagement ist, die Bilanz genau unter die Lupe zu nehmen. Hier schlummern möglicherweise Reserven, die die Finanzierungssituation entscheidend beeinflussen können. Stille Reserven spielen also eine wichtige Rolle. Allerdings ist die Thematik nicht selten auch sehr komplex und mit Schätzwerten verbunden. Hier sollte besser einmal mehr mit Buchhaltung und Steuerberatung Rücksprache gehalten werden, damit Transparenz hergestellt werden kann.
Klar ist auch: Die Vermögenswerte sollten regelmäßig geprüft und analysiert werden. Gerade beim Immobilienmarkt haben sich beispielsweise über die Jahre viele Werte verändert. Unternehmen sollten sich deshalb über die eigenen Vermögenswerte Klarheit verschaffen.