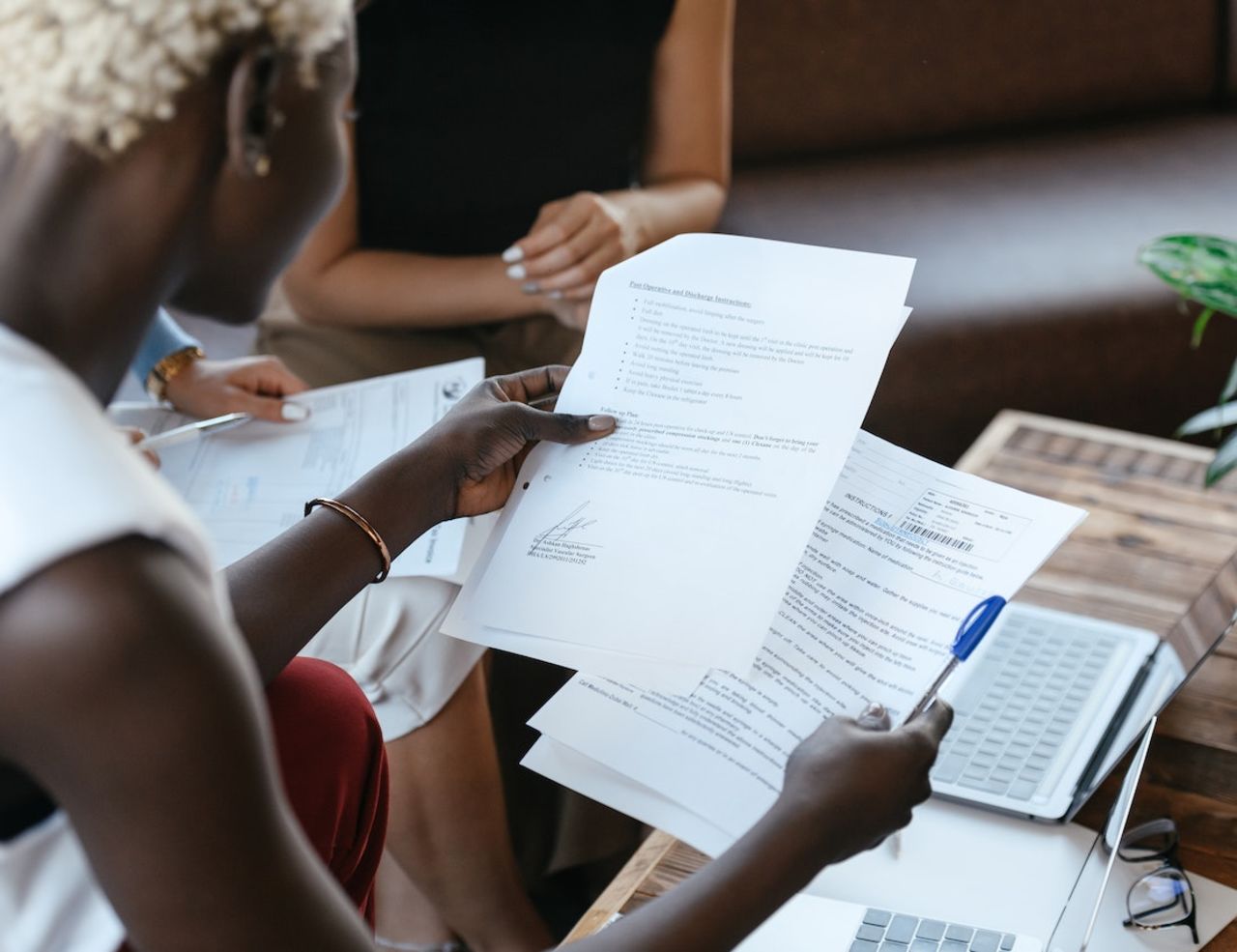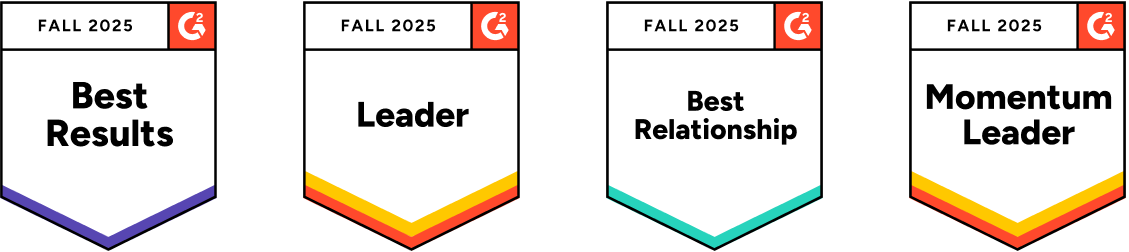Alles, was Sie zu Open Banking wissen müssen


Der Open-Banking-Markt soll bis 2031 um knapp 41 Prozent pro Jahr wachsen. Damit zählt der Markt zu den wachstumsstärksten überhaupt. Doch was genau verbirgt sich eigentlich hinter Open Banking? Wir geben Ihnen in diesem Artikel einen detaillierten Einblick ins Thema und erklären, warum diese Technologie die Finanzbranche revolutionieren könnte.
Definition: Was ist Open Banking?
Open Banking ist eine Praxis, bei der Banken Kunden- und sonstige Daten durch APIs (Application Programming Interfaces), also dafür programmierte Schnittstellen, Dritten zugänglich machen. So können Fintechs, andere Banken und jeder beliebige Drittanbieter auf diese Daten zugreifen und sie nutzen – sei es für eigene Apps und Dienste oder zum Abgleich von Finanzdaten.
Im Kern basiert Open Banking auf der Idee, dass die Daten, die eine Person bei ihrer Bank gespeichert hat, nicht nur von diesem Finanzinstitut selbst, sondern – immer die Zustimmung des oder der Kund:in vorausgesetzt – auch von anderen Dienstleistern genutzt werden können. Solche Dienstleister, oft sind es Unternehmen aus der Finanzbranche, können dann wiederum maßgeschneiderte Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten, die auf die Bedürfnisse der einzelnen Kund:innen abgestimmt sind.
In Europa ist Open Banking seit 2018 in aller Munde, seit September 2019 sind Banken dazu verpflichtet, Drittanbietern Daten über eine API zur Verfügung zu stellen. Die Grundlage dafür PSD2 (Payment Services Directive), auch unter der deutschen Bezeichnung Zweite Zahlungsdiensterichtlinie bekannt.

Was ist das Ziel von Open Banking?
Ziel von Open Banking ist es, mehr Wettbewerb und Innovation im Finanzsektor zu fördern und Verbraucher:innen und Unternehmen eine größere Auswahl und Kontrolle über ihre Finanzdaten zu bieten. Die PSD2 soll gleichzeitig auch die Sicherheit im (europäischen) Zahlungsverkehr verbessern.
Vor allem in Europa treibt der Finanzsektor Open Banking voran. Großbritannien etwa ist mit sieben Millionen Open-Banking-User:innen führend. In den USA verläuft Open Banking schleppender, aktuell (Stand: Mitte 2024) wird eine nationale Open-Banking-Richtlinie weiter diskutiert.
Was versteht man unter Open Finance?
Im Zusammenhang mit Open Banking fällt auch immer wieder das Stichwort Open Finance. Dieses Konzept erweitert Open Banking und bezieht sich auf die breitere Öffnung und Vernetzung von Finanzdaten über traditionelle Bankkonten hinaus.
Während Open Banking in erster Linie den Zugriff und die Nutzung von Bankkontodaten meint, umfasst Open Finance eine größere Vielfalt an Finanzdaten, dazu zählen etwa
- Versicherungen,
- Renten,
- Hypotheken sowie
- weitere Finanzprodukte und -dienstleistungen.
Open Banking ist also vereinfacht gesprochen ein Teil von Open Finance. Der Kerngedanke hinter Open Finance ist, dass Kund:innen – B2C wie B2B – nicht nur einen umfassenden Zugriff und die Kontrolle über ihre gesamten Bankdaten, sondern alle irgendwie ihre Finanzen betreffenden Daten haben sollten.
Open Finance setzt dabei wie Open Banking auf die Verwendung von APIs, um einen sicheren Datenaustausch zu gewährleisten. In vielen Regionen, auch in der Europäischen Union, werden die rechtlichen Rahmenbedingungen für Open Finance noch diskutiert und entwickelt, wobei die Erfahrungen aus Open Banking oft als Grundlage dienen.
Wie funktioniert Open Banking?
Im Zentrum von Open Banking stehen APIs, die einen sicheren und standardisierten Weg für den Datenaustausch zwischen Banken und Drittanbietern ermöglichen.
Der Prozess lässt sich auf wenige Schlüsselschritte herunterbrechen:
- Zugriffsgenehmigung: Alles beginnt mit der Zustimmung des oder der Kund:in. Ohne Zustimmung kann kein Drittanbieter auf Daten zugreifen. Diese wird meist über ein Online-Banking-Portal der Bank geregelt.
- API-Aufrufe: Sobald die Zustimmung vorliegt, kann der Drittanbieter über die API spezifische Daten abrufen, die die Privat- und Geschäftskund:innen freigegeben haben. Kontostände, Kontobewegungen oder Zahlungsanweisungen – alle relevanten Daten sind abrufbar.
- Datennutzung: Die abgerufenen Daten werden jetzt von den Drittanbietern genutzt, um ihre Dienstleistungen zu erbringen. Ein simples Beispiel aus dem B2C-Bereich: Eine Finanzapp könnte sämtliche Kontobewegungen in Konten mehrerer Banken auf einem Dashboard zusammenfassen. Im B2B-Bereich könnte so die Liquidität über mehrere Konten zentral aufbereitet werden.
Um die Sicherheit während des gesamten Prozesses zu gewährleisten, verwenden Open-Banking-APIs Sicherheitsprotokolle wie OAuth und TLS, um die Datenübertragung zu verschlüsseln und den Zugang zu kontrollieren. Jeder API-Aufruf ist durch strenge Authentifizierungs- und Autorisierungsprozesse geschützt – so ist sichergestellt, dass nur berechtigte Anfragen bearbeitet werden.
Akteure und Dienstleister im Open-Banking-Kosmos im Überblick
Am Open Banking sind neben Unternehmen als „Endnutzer:innen“ also mehrere Akteure und Dienstleister beteiligt, die gemeinsam ein funktionierendes Ökosystem bilden. In erster Linie sind das Banken, Drittanbieter und Technologieanbieter. Wir stellen Ihnen alle drei im Detail vor.
Banken
Banken und Finanzinstitute sind die primäre Datenquelle, die ihre APIs für den Zugriff auf Kontoinformationen und die Initiierung von Zahlungen öffnen müssen. Große und kleine Banken haben unterschiedliche Strategien und Fähigkeiten bei der Implementierung von Open Banking entwickelt. Das sorgt dafür, dass die Anbindung an manche Banken einfacher ist – während es jedoch auch viele Finanzinstitute gibt, die mit der fortschreitenden Digitalisierung nur schwer Schritt halten können.
Drittanbieter (Third Party Providers, TPPs)
Diese Gruppe umfasst FinTech-Unternehmen, Zahlungsdienstleister, Finanz- und Treasury-Management-Apps wie Agicap und andere Akteure, die die durch die Schnittstellen der Banken und Banking-Dienste zugänglichen Daten für ihre eigenen Produkte und Dienstleistungen nutzen.
TPPs werden in der Regel in zwei Kategorien unterteilt:
- Zahlungsauslösedienste (Payment Initiation Service Providers, PISPs): Diese ermöglichen es Nutzer:innen, Zahlungen direkt von ihren Bankkonten aus zu initiieren – ohne den Einsatz von Kreditkarten oder der einer traditionellen Banküberweisung.
- Kontoinformationsdienste (Account Information Service Providers, AISPs): Sie bieten Nutzer:innen einen konsolidierten Überblick über ihre Finanzen und Kontostände, oft über mehrere Banken hinweg. Agicap ist hier ein passendes Beispiel, das über seine Bank-ERP-Anbindung sämtliche Zahlungsströme konsolidiert und auf einem Dashboard sichtbar macht.
Technologieanbieter
Damit die beiden erstgenannten Akteure interagieren und Daten austauschen können, sind Technologieanbieter als „Verbindungspunkte“ nötig. Sie liefern die notwendige Infrastruktur, Softwarelösungen und Sicherheitstechnologien, die das Ökosystem unterstützen.
Diese Anbieter entwickeln und warten die APIs, Sicherheitsprotokolle und Kommunikationsstandards, die für sicheres Open Banking erforderlich sind.
Regulierungsbehörden
Zusätzlich spielen Regulierungsbehörden eine wesentliche Rolle im Open-Banking-Ökosystem, auch wenn sie nicht direkt am vorgestellten Prozess beteiligt sind.
Denn: Sie setzen die rechtlichen Rahmenbedingungen, an die sich alle Akteure in der Praxis halten müssen. Dazu zählen unter anderem
- Datenschutzbestimmungen,
- Sicherheitsstandards und die
- Einhaltung von Finanzvorschriften.
In Europa regelt das primär die bereits erwähnte PSD2-Richtlinie, die die Grundlage für das Open Banking schafft.
Wie sicher ist Open Banking?
Trotz der Regulierung und damit verbundener Vorschriften sehen einige Marktteilnehmer:innen, oft auch Privatpersonen, Open Banking aufgrund der Sicherheitsfrage kritisch. Experten wie Thomas Hertel warnen etwa vor den Risiken und erwarten von den Beteiligten des Ökosystems, dass diese „Lösungen anbieten müssen, die das Vertrauen der Kunden durch sichere Anwendungen fördern.“
Die meisten Akteure im Open-Banking-Kosmos tun genau das. Open Banking nutzt fortschrittliche Sicherheitsprotokolle und -technologien, um den Schutz der sensiblen Finanzdaten aller Nutzer:innen zu gewährleisten. Dazu gehören:
- Sichere Authentifizierungs- und Autorisierungsmethoden: Zum Standard zählt das Protokoll OAuth 2.0, das für die sichere Autorisierung von Web-, Mobile- und Desktop-Applikationen verwendet wird.
- Verschlüsselte Datenübertragungen: Die Übertragung von Daten zwischen Banken, Drittanbietern und Nutzer:innen erfolgt über verschlüsselte Verbindungen, typischerweise mittels TLS (Transport Layer Security).
- Strenge Datenschutzrichtlinien: In der EU schreibt die PSD2 etwa vor, dass alle Zahlungsdiensteanbieter die „Starke Kundenauthentifizierung“ (Strong Customer Authentication, SCA) verwenden müssen, um die Sicherheit von Online-Zahlungen und den Zugang zu sensiblen Kundendaten zu erhöhen.
Vorteile von Open Banking für Unternehmen
Mehr Innovation und verstärkter Wettbewerb
Durch das Öffnen der Bankdaten für Drittanbieter entsteht ein wettbewerbs- und innovationsförderndes Umfeld. Neue Player haben die Möglichkeit, mit ihren Produkten und Dienstleistungen auf dem bisher sehr klassischen Finanzmarkt innovative Lösungen zu bieten, die traditionellen Bankprodukten möglicherweise überlegen sind.
In der Konsequenz bedeutet der verstärkte Wettbewerb: bessere, neue Produkte und Dienstleistungen sowie niedrigere Preise für Privat- und Geschäftskund:innen, die gleichzeitig auch von einer verbesserten Nutzererfahrung profitieren.
Gesteigerte Effizienz bei weniger Kosten für Unternehmen
Für Unternehmen jeglicher Größe und aus allen Branchen kann Open Banking zu erheblichen Effizienzsteigerungen führen. Indem sie bisher aufwändige Finanzprozesse rund um das Liquiditätsmanagement vereinheitlichen und automatisieren – etwa Echtzeit-Übersichten über die Liquidität des Gesamtkonzerns oder Zahlungsabwicklungen – sparen sie Zeit und Kosten.
Verbesserter Zugang zu Finanzdienstleistungen
Open Banking kann den Zugang zu Finanzprodukten und -dienstleistungen erweitern – besonders für bisher „unterversorgte“ Gruppen, wozu auch kleinere Unternehmen zählen.
Durch die Nutzung von Echtzeit-Daten können zum Beispiel Kreditentscheidungen schneller und auf Basis aktuellerer Informationen getroffen werden.
Nachteile und Herausforderungen von Open Banking
Steigende Anforderungen an Sicherheit und Datenschutz
Unternehmen stehen vor erheblichen Herausforderungen im Bereich der Sicherheit und des Datenschutzes, wenn sie Open Banking implementieren. Sämtliche Prozesse müssen den vorgestellten Datenschutzbestimmungen zu entsprechen und gleichzeitig ein hohes Maß an Datensicherheit gewährleisten – das ist in der Regel mit spürbaren Investitionen verbunden.
Komplexität der Integration
Die Integration von Open-Banking-APIs in bestehende Systeme muss nicht, kann aber komplex und kostspielig sein. Unternehmen müssen ihre IT-Infrastruktur und Geschäftsprozesse anpassen, um die APIs effektiv nutzen zu können.
Regulatorische Compliance
Die Einhaltung der sich immer wieder ändernden regulatorischen Vorgaben stellt für viele Unternehmen eine weitere Herausforderung dar. Die Notwendigkeit, sich an unterschiedliche Gesetze und Normen in verschiedenen Märkten anzupassen, kann die Komplexität und die Kosten der Umsetzung von Open Banking erhöhen.
Wettbewerbsdruck und Marktdisruption
Open Banking erhöht den Wettbewerb im Finanzsektor, indem es neuen Akteuren ermöglicht, innovative Finanzdienstleistungen anzubieten. Für etablierte Unternehmen kann das bedrohlich sein, da sie sich mit disruptiven Geschäftsmodellen auseinandersetzen müssen.
Klar ist aber auch: Dieser Nachteil für Player aus der Finanzwelt ist ein Vorteil für alle Unternehmen, die Open-Banking-Systeme einsetzen. Sie profitieren vom steigenden Konkurrenzdruck in Form von mehr Angebot und niedrigeren Preisen.
Beispiele für Open Banking in der Praxis
Trotz der Herausforderungen und einigen wenigen Nachteilen gilt Open Banking als Zukunft des Finanzwesens. In der Praxis wird Open Banking schon heute durch eine Vielzahl von Anwendungen und Dienstleistungen realisiert, die das finanzielle Ökosystem erheblich erweitern.
Wir stellen Ihnen einige Beispiele vor:
- Kontenaggregation: Mit Tools wie Agicap können Sie als Unternehmer:in oder Finanzverantwortliche:r sämtliche Zahlungsströme aller vorhandenen Bankkonten über eine Bank-Anbindung in einem Dashboard visualisieren und auch in Ihr ERP integrieren. Durch diese Kontenaggregation (vereinfacht ausgedrückt: Zusammenführung aller Bankkonten in eine Übersicht) sparen Sie sich das manuelle Einloggen in verschiedene Konten zur Liquiditätsübersicht und Zahlungsanweisung, etwa für SEPA-Lastschriften in Echtzeit.
- Sofortige Kreditbewertung: Open Banking kann auch von Banken und anderen Kreditgebern genutzt werden, um fast in Echtzeit die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens zu ermöglichen.
- Persönliches Finanzmanagement: Auch im Privatkundenbereich gibt es viele Anwendungsbeispiele. Apps wie Finanzguru haben ähnliche Funktionen, wie sie Agicap für Unternehmen bietet. Sie helfen Nutzer:innen, ihre Ausgaben zu kategorisieren und Budgets besser zu verwalten.
Gerade die Konten- und Finanzdatenaggregation ist einer der Hauptanwendungsfälle für Open Banking. Viele unserer Kund:innen bei Agicap profitieren davon. Ein Beispiel ist Thomas Hornberger, der als Interim-CFO in seiner Beratungsfirma Hornberger Consulting mittelständische und große Unternehmen mit mehr als 100 Millionen Euro Jahresumsatz unterstützt.
Als CFO braucht er eine hohe Plangenauigkeit bei hoher Geschwindigkeit – daran scheitern ERP-Treasury-Tools und manuelle Excel-Tools oft. „Agicap schien mir deshalb die ideale Lösung für dieses Problem zu sein. Mit der Einführung von Agicap konnten wir den Aufwand für die Datenzusammenführung und Darstellung um 90 % reduzieren“, erklärt Thomas Hornberger auf Nachfrage.
Banken- und ERP-Anbindung als Schlüssel
Das konkrete Praxisbeispiel zeigt, wie gewinnbringend Open Banking für Unternehmen sein kann. Im Zentrum steht dabei in der Regel eine Banken- und ERP-Anbindung.
Bei Agicap stellen wir Ihnen in diesem Szenario eine Multi-Bank-Konnektivität und ERP-Schnittstelle zur Datenaggregation und Zahlungsabwicklung bereit. Diese berücksichtigt mehrere unterschiedliche Protokolle wie PSD2, EBICS, SWIFT, H2H und SFTP, wodurch sie global eingesetzt werden kann.
So erhalten Sie eine einzige Benutzeroberfläche, auf der Sie nicht nur sämtliche Liquiditätsströme einsehen und auswerten können, sondern auch Zahlungen über verschiedene Methoden (EBICS TS, CML, Pivot-Konto) vornehmen können.
Fazit: Open Banking ist die Zukunft
Die Zukunft von Open Banking ist sehr vielversprechend aus, da es die Grundlage für tiefergreifende Innovationen bildet. Mit der Weiterentwicklung von Schlüsseltechnologien wie KI und maschinellem Lernen werden Open-Banking-Plattformen immer stärker dazu befähigt, noch bessere, personalisiertere und proaktivere Produkte anzubieten. Unternehmen profitieren davon, indem sie ihre Finanzen so besser steuern und planen können.
Auch Deloitte geht davon aus, dass Open Banking und kommende Änderungen, etwa die Einführung der neuen PSD3-Richtlinie, „die etablierten Geschäftsmodelle in der Finanzbranche auf die Probe“ stellt und Player aus der Branche gezwungen werden, „sich stärker auf kundenzentrierte Lösungen zu fokussieren.“
Auch bei Agicap erkennen wir die Notwendigkeit, mit der Digitalisierung zu gehen. Unser Tool schließt die Lücke zwischen Banken, Banking-Diensten und ERP-Systemen. Falls Sie mehr darüber erfahren möchten, wie wir Open Banking zu Ihrem Vorteil nutzen, werfen Sie einen Blick in unsere Masterclass zum Thema!

FAQ: Meistgestellte Fragen zu Open Banking
Wer nutzt Open Banking?
Open Banking wird von einer Vielzahl von Nutzenden eingesetzt, darunter Privatpersonen, die ihre Finanzen besser verwalten möchten, KMU, die effizienteren Zugang zu Finanzdienstleistungen suchen, sowie FinTechs und große Unternehmen, die innovative Finanzprodukte entwickeln. Auch traditionelle Banken nutzen Open Banking, um neue Dienstleistungen zu bieten und interne Prozesse im Core Banking zu verbessern. Dieses System ermöglicht es allen Nutzer:innen, maßgeschneiderte und effiziente Finanzlösungen zu nutzen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Wofür werden APIs beim Open Banking verwendet?
APIs (Application Programming Interfaces) kommen im Open Banking zum Einsatz, um den sicheren Datenaustausch zwischen Banken, Finanzdienstleistern und Drittanbietern zu abzuwickeln. Auf der Nutzerseite wiederum ermöglichen sie es Anwender:innen (B2C oder B2B), ihre Finanzdaten über verschiedene Finanzinstitutionen hinweg zu verwalten und zu integrieren.
Wie lange dauert Open Banking?
Open Banking ist kein Prozess mit einer festen Dauer, sondern vielmehr ein fortlaufendes System. Einmal implementiert, ist Open Banking immer aktiv und ermöglicht dann die schnellere Abwicklung von Finanztransaktionen wie Konten- und Datenaggregationen oder Zahlungsabwicklungen.
Welche Open-Banking-Anbieter gibt es?
Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Anbietern, die Open-Banking-Lösungen im Portfolio haben, viele Unternehmen und FinTechs sind erst durch die Möglichkeiten, die Open Banking bietet, entstanden. Agicap ist ein Unternehmen, in dessen Zentrum Open Banking steht, um Dienste wie eine Banken- und ERP-Verbindung und zahlreiche weitere Integrationen anzubieten.