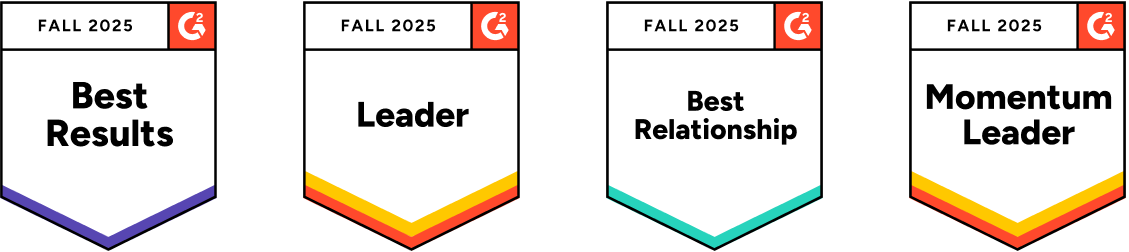Kennzahlen im Controlling: Übersicht, Beispiele und Vor- und Nachteile


Controlling Kennzahlen: Übersicht, Beispiele und Vor- und Nachteile
Kaum ein Instrument ist im Controlling so beliebt und häufig im Einsatz wie Kennzahlen. Sie sind für die Steuerung eines Unternehmens und als Teilfunktion der Unternehmensführung essenziell. Sie ermöglichen eine tiefergehende Analyse verschiedener Bezugsgrößen. Für Unternehmen ist es damit möglich zu messen, ob gesetzte Ziele erreicht wurden oder das Unternehmen gar in eine leichte Schieflage gerät.
Kennzahlen im Controlling: Definition und Synonym
Kennzahlen werden häufig auch als betriebliche Kennziffern bezeichnet. Nach gängiger Definition handelt es sich hierbei um die Zusammenfassung von quantitativen, d.h. in Zahlen ausdrückbaren Informationen (vgl. zum Beispiel Wirtschaftslexikon Gabler). Viele Kennzahlen werden auf Basis einer Formel berechnet.
Häufig fällt im Zusammenhang mit Kennzahlen der Begriff KPI (Key Performance Indicator). Auch KPIs sind Kennzahlen - aber solche, die sich darauf beziehen, ob bestimmte Unternehmensleistungen erreicht wurden. Deshalb sind KPI und Kennzahlen nicht immer synonym zu verwenden.
Unterschied zwischen Kennzahlen und KPIs
Kennzahlen und KPIs (Key Performance Indicators) sind beide wichtige Werkzeuge im Controlling, um die Leistung eines Unternehmens zu messen und zu steuern. Der Hauptunterschied zwischen Kennzahlen und KPIs liegt jedoch in ihrer spezifischen Funktion und ihrem Einsatz.
Kennzahlen sind allgemeine, quantifizierte Informationen, die die Leistung eines Unternehmens oder einer Organisation darstellen. Sie können finanzielle oder nicht-finanzielle Daten umfassen und dienen als Grundlage für die Entscheidungsfindung. Beispiele für allgemeine Kennzahlen sind Umsatz, Kosten und Gewinn.
KPIs hingegen sind spezifische Kennzahlen, die die Erreichung von Zielen und die Erfüllung von Anforderungen messen. Sie sind eng mit den strategischen Zielen eines Unternehmens verbunden und dienen als Indikatoren für die Erfolgsmessung. Ein KPI könnte beispielsweise die Kundenzufriedenheit oder die Mitarbeiterproduktivität messen.
Insgesamt können Kennzahlen und KPIs als komplementäre Werkzeuge im Controlling betrachtet werden. Während Kennzahlen eine breite Palette von Informationen liefern, konzentrieren sich KPIs auf spezifische, wichtige Aspekte der Unternehmensleistung. Durch den gezielten Einsatz von KPIs können Unternehmen sicherstellen, dass sie ihre strategischen Ziele erreichen und ihre Leistung kontinuierlich verbessern.

Arten von Kennzahlen: Absolute und relative Kennzahlen
In der Literatur wird häufig zwischen absoluten und relativen Kennzahlen unterschieden:
- Eine absolute Kennzahl kann direkt der jeweiligen Datenquelle entnommen werden (zum Beispiel Umsatz).
- Eine relative Kennzahl wird ermittelt, indem mindestens zwei absolute Kennzahlen miteinander ins Verhältnis gesetzt werden (zum Beispiel die Eigenkapitalquote).
Bilanzkennzahlen
Bilanzkennzahlen sind eine Art von Kennzahlen, die sich auf die Bilanz eines Unternehmens beziehen. Sie dienen dazu, die finanzielle Situation eines Unternehmens zu analysieren und zu bewerten. Bilanzkennzahlen sind wichtig, um die finanzielle Stabilität und die Rentabilität eines Unternehmens zu beurteilen. Sie können auch dazu dienen, die Unternehmensstrategie zu entwickeln und zu überwachen.
Einige Beispiele für Bilanzkennzahlen sind:
- Eigenkapitalquote: Diese Kennzahl gibt das Verhältnis von Eigenkapital zu Gesamtkapital an und zeigt, wie viel des Unternehmensvermögens durch Eigenkapital finanziert ist. Eine hohe Eigenkapitalquote deutet auf eine solide finanzielle Basis hin.
- Verschuldungsquote: Diese Kennzahl misst das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital und gibt Aufschluss über die finanzielle Abhängigkeit des Unternehmens von externen Geldgebern. Eine niedrige Verschuldungsquote ist in der Regel wünschenswert, da sie auf eine geringere finanzielle Belastung hinweist.
- Anlagenintensität: Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis von Anlagevermögen zu Gesamtvermögen und gibt an, wie stark das Unternehmen in langfristige Vermögenswerte investiert ist. Eine hohe Anlagenintensität kann auf eine kapitalintensive Branche hinweisen.
Durch die Analyse dieser und anderer Bilanzkennzahlen können Unternehmen fundierte Entscheidungen treffen und ihre finanzielle Gesundheit überwachen.
Liquiditätskennzahlen
Liquiditätskennzahlen sind eine Art von Kennzahlen, die sich auf die Liquidität eines Unternehmens beziehen. Sie dienen dazu, die Fähigkeit eines Unternehmens zu beurteilen, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu bedienen. Liquiditätskennzahlen sind wichtig, um die Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens zu beurteilen und um die Risiken von Zahlungsunfähigkeit zu minimieren.
Einige Beispiele für Liquiditätskennzahlen sind:
- Liquidität ersten Grades: Diese Kennzahl misst das Verhältnis von flüssigen Mitteln zu kurzfristigen Verbindlichkeiten. Sie gibt an, wie gut ein Unternehmen in der Lage ist, seine kurzfristigen Schulden sofort zu begleichen. Eine hohe Liquidität ersten Grades ist ein Zeichen für eine gute kurzfristige Zahlungsfähigkeit.
- Liquidität zweiten Grades: Diese Kennzahl erweitert die Liquidität ersten Grades um kurzfristige Forderungen. Sie gibt das Verhältnis von flüssigen Mitteln und kurzfristigen Forderungen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten an. Diese Kennzahl bietet einen umfassenderen Blick auf die kurzfristige Liquidität des Unternehmens.
- Liquidität dritten Grades: Diese Kennzahl umfasst zusätzlich zu den flüssigen Mitteln und kurzfristigen Forderungen auch die Vorräte. Sie gibt das Verhältnis von flüssigen Mitteln, kurzfristigen Forderungen und Vorräten zu kurzfristigen Verbindlichkeiten an. Eine hohe Liquidität dritten Grades zeigt, dass das Unternehmen auch durch den Verkauf von Vorräten seine kurzfristigen Verbindlichkeiten decken kann.
Durch die regelmäßige Überwachung dieser Liquiditätskennzahlen können Unternehmen sicherstellen, dass sie jederzeit zahlungsfähig bleiben und finanzielle Engpässe vermeiden.
Einsatz von Kennzahlensystemen: Planung und Reporting
Kennzahlen können Schwachstellen und Entwicklungen offenlegen. Deshalb sind sie eine wichtige Unterstützung in Entscheidungsprozessen. Das Controlling setzt Kennzahlen vielfach ein, beispielsweise in der Planung oder auch im Reporting. Werden Kennzahlen kombiniert, können Kennzahlensysteme, wie zum Beispiel die Balanced Scorecard oder das Return on Investment-Kennzahlensystem, eingeführt werden.
Kennzahlen zur Unternehmensanalyse nutzen
Kennzahlen können im innerbetrieblichen Bereich, aber auch aus externer Sicht betrachtet werden. Gerade bei der Bilanzanalyse kommen beispielsweise Kennzahlen üblicherweise zum Einsatz. Potenzielle Investoren oder Kreditgeber fordern daher häufig Informationen, um bestimmte Kennzahlen interpretieren zu können.
Wertorientierte Kennzahlen
Wertorientierte Kennzahlen liefern Erkenntnisse, wie sich der Unternehmenswert entwickelt hat.
Wichtige Kennzahlen im Unternehmen: Übersicht
Welche Kennzahlen für ein Unternehmen wichtig sind, kann variieren. So spielen beispielsweise die Unternehmensgröße, -rechtsform und die Branchenzugehörigkeit eine Rolle. Ein produzierendes Unternehmen interessiert sich ggf. für andere Kennzahlen als ein Beratungsunternehmen.
Kennzahlen können differenziert werden, beispielsweise in
- Rentabilitätskennzahlen
- Liquiditätskennzahlen
- Finanzierungskennzahlen
Aus folgender Übersicht können Sie beispielhaft Kennzahlen entnehmen, die sehr häufig zum Einsatz kommen:
Rentabilitätskennzahlen
- Gesamtkapitalrentabilität
- Eigenkapitalrentabilität
- Umsatzrentabilität
Liquiditätskennzahlen
Finanzierungskennzahlen
- Eigenkapitalquote
- Fremdkapitalquote
- Verschuldungsgrad
Weitere wichtige Unternehmenskennzahlen
- Umschlagshäufigkeit
- Debitoren- und Kreditorenkennzahlen
- Anlagedeckung
- Kapitalumschlag
- Vorratsquote
- Kennzahlen zur Gewinnverwendung
- Market Value added
- Economic Value added
Wichtige Controlling-KPIs im Detail
Fixkosten-Proportionalisierung
Die Fixkosten-Proportionalisierung ist eine Methode, bei der die gesamten Fixkosten eines Unternehmens auf die einzelnen Produkteinheiten umgelegt werden, um die Selbstkosten pro Stück zu ermitteln. Dies ist entscheidend für die genaue Kalkulation von Verkaufspreisen und die Analyse der Wirtschaftlichkeit jedes Produkts. Durch die Aufteilung der Fixkosten können Unternehmen feststellen, wie viel jede Einheit zur Deckung der Fixkosten beitragen muss, bevor ein Gewinn erzielt wird.
Beispiel: Angenommen, ein Unternehmen hat monatliche Fixkosten von 10.000 €, einschließlich Miete, Gehälter und Versicherungen. Wenn das Unternehmen 1.000 Produkteinheiten herstellt, betragen die Fixkosten pro Einheit:
Fixkosten pro Einheit = Gesamte Fixkosten ÷ Anzahl der produzierten Einheiten
Fixkosten pro Einheit = 10.000 € ÷ 1.000 = 10 €
Diese 10 € werden zu den variablen Kosten pro Einheit hinzugefügt, um die Gesamtkosten pro Einheit zu bestimmen. Wenn die variablen Kosten 15 € betragen, sind die Selbstkosten pro Einheit 25 €. Dieses Wissen ermöglicht es dem Unternehmen, einen Verkaufspreis festzulegen, der sowohl die Kosten deckt als auch einen angemessenen Gewinn erzielt.
Unit Economics
Unit Economics beschäftigt sich mit den Einnahmen und Ausgaben, die mit einer einzelnen Geschäftseinheit verbunden sind. Es geht darum zu verstehen, wie profitabel jede verkaufte Einheit ist und wie sie zum Gesamterfolg des Unternehmens beiträgt. Eine gründliche Analyse der Unit Economics hilft Unternehmen dabei, fundierte Entscheidungen über Preisgestaltung, Marketingstrategien und Produktentwicklung zu treffen.
Deckungsbeitrag pro Einheit
Der Deckungsbeitrag pro Einheit ist ein zentrales Element der Unit Economics und zeigt, wie viel jede verkaufte Einheit zur Deckung der Fixkosten und zur Gewinnerzielung beiträgt. Er wird berechnet durch:
Deckungsbeitrag pro Einheit = Verkaufspreis pro Einheit -- Variable Kosten pro Einheit
Ein positiver Deckungsbeitrag ist essentiell, da nur dann die Fixkosten gedeckt und Gewinne erzielt werden können.
Beispiel: Ein Unternehmen verkauft ein Produkt für 50 € pro Einheit. Die variablen Kosten betragen 30 € pro Einheit (Material, Produktion, Versand). Der Deckungsbeitrag pro Einheit ist:
Deckungsbeitrag pro Einheit = 50 € -- 30 € = 20 €
Dieser Betrag steht zur Deckung der Fixkosten zur Verfügung. Je höher der Deckungsbeitrag, desto schneller können Fixkosten gedeckt und Gewinne erzielt werden.
Break-even Point
Der Break-even Point ist der Punkt, an dem die Gesamterlöse eines Unternehmens genau den Gesamtkosten entsprechen, sodass weder Gewinn noch Verlust entsteht. Er gibt die Mindestmenge an, die verkauft werden muss, um die Kosten zu decken.
Break-even-Menge = Fixkosten ÷ Deckungsbeitrag pro Einheit
Beispiel: Mit Fixkosten von 10.000 € und einem Deckungsbeitrag pro Einheit von 20 € muss das Unternehmen mindestens verkaufen:
Break-even-Menge = 10.000 € ÷ 20 € = 500
Das Unternehmen muss also 500 Einheiten verkaufen, um kostendeckend zu arbeiten. Verkäufe über dieser Menge führen zu Gewinnen.
Deckungsbeitragsquote (Contribution Margin)
Die Deckungsbeitragsquote gibt den prozentualen Anteil des Deckungsbeitrags am Umsatz an und hilft dabei, die Kostenstruktur eines Unternehmens zu bewerten.
Deckungsbeitragsquote = (Deckungsbeitrag ÷ Umsatz) × 100 %
Eine hohe Deckungsbeitragsquote deutet darauf hin, dass ein großer Teil des Umsatzes zur Deckung der Fixkosten und zur Gewinnerzielung verwendet werden kann.
Beispiel: Ein Unternehmen erzielt einen Umsatz von 100.000 € und einen Deckungsbeitrag von 40.000 €.
Deckungsbeitragsquote = (40.000 € ÷ 100.000 €) × 100 % = 40 %
Dies bedeutet, dass 40 % des Umsatzes zur Deckung der Fixkosten und zur Gewinnerzielung beitragen.
Customer Lifetime Value (CLV)
Der Customer Lifetime Value (CLV) misst den gesamten Wert, den ein Kunde über die gesamte Geschäftsbeziehung hinweg generiert. Er hilft Unternehmen zu verstehen, wie viel sie in die Akquisition und Bindung eines Kunden investieren sollten.
CLV = Durchschnittlicher Umsatz pro Kunde × Kundenbindungsdauer × Gewinnmarge
Beispiel: Ein Abonnementdienst hat Kunden, die durchschnittlich 50 € pro Monat ausgeben. Die durchschnittliche Kundenbindungsdauer beträgt 24 Monate, und die Gewinnmarge liegt bei 25 %.
CLV = 50 € × 24 × 25 % = 300 €
Ein hoher CLV ermöglicht es dem Unternehmen, mehr in Marketing und Kundenservice zu investieren, um weitere Kunden zu gewinnen und bestehende zu halten.
Customer Acquisition Cost (CAC)
Die Customer Acquisition Cost (CAC) zeigt, wie viel es durchschnittlich kostet, einen neuen Kunden zu gewinnen. Sie ist ein entscheidender Faktor bei der Beurteilung der Effizienz von Marketing- und Vertriebsstrategien.
CAC = Summe der Marketing- und Vertriebskosten ÷ Anzahl der neu gewonnenen Kunden
Beispiel: Ein Unternehmen gibt im Monat 15.000 € für Marketing und Vertrieb aus und gewinnt dadurch 50 neue Kunden.
CAC = 15.000 € ÷ 50 = 300 €
Ein niedriger CAC ist wünschenswert, da er auf eine effiziente Kundengewinnung hindeutet.
Verhältnis von CLV zu CAC
Das Verhältnis von Customer Lifetime Value zu Customer Acquisition Cost ist ein wichtiger Indikator für die Rentabilität der Kundenakquise. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass der Wert eines Kunden die Kosten für seine Gewinnung deutlich übersteigt.
CLV zu CAC Verhältnis = Customer Lifetime Value ÷ Customer Acquisition Cost
Beispiel: Mit einem CLV von 300 € und einem CAC von 100 € ergibt sich:
CLV zu CAC Verhältnis = 300 € ÷ 100 € = 3
Ein Verhältnis von mindestens 3:1 gilt als gesund. Branchenübergreifend streben Unternehmen dieses Verhältnis oder höher an, um sicherzustellen, dass die Investitionen in Marketing und Vertrieb rentabel sind.
Rule of 40
Die Rule of 40 ist eine Kennzahl, die insbesondere für SaaS-Unternehmen und Start-ups relevant ist. Sie besagt, dass die Summe aus prozentualem Umsatzwachstum und EBITDA-Marge mindestens 40 % betragen sollte. Dies hilft Investoren und Managern, ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Profitabilität zu bewerten.
Beispiel: Ein Unternehmen weist ein jährliches Umsatzwachstum von 25 % und eine EBITDA-Marge von 20 % auf.
Summe = 25 % + 20 % = 45 %
Da die Summe über 40 % liegt, erfüllt das Unternehmen die Rule of 40 und wird als finanziell gesund betrachtet. Unternehmen können entscheiden, ob sie mehr in Wachstum oder Profitabilität investieren möchten, solange die Summe den Richtwert erreicht.
Budget vs. Actual (Soll-Ist-Vergleich)
Der Soll-Ist-Vergleich ist ein wesentliches Instrument im Controlling, das die geplanten Budgets (Soll) mit den tatsächlichen Ergebnissen (Ist) vergleicht. Dieser Vergleich hilft Unternehmen, Abweichungen zu identifizieren, die Ursachen zu analysieren und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
Beispiel: Ein Unternehmen plant monatliche Vertriebsaufwendungen von 20.000 €, gibt tatsächlich aber 25.000 € aus.
Abweichung = 25.000 € -- 20.000 € = 5.000 €
Prozentuale Abweichung = (5.000 € ÷ 20.000 €) × 100 % = 25 %
Durch diesen Vergleich kann das Management untersuchen, warum die Ausgaben höher waren--beispielsweise durch unerwartete Marketingkampagnen--und zukünftige Budgets entsprechend anpassen.
Vertriebseffizienz
Die Vertriebseffizienz misst, wie effektiv ein Unternehmen seine Vertriebs- und Marketingressourcen einsetzt, um Umsatzwachstum zu generieren. Sie hilft, die Rentabilität von Investitionen in diese Bereiche zu bewerten.
Sales Efficiency
Die Sales Efficiency gibt an, wie viel Umsatzwachstum pro investiertem Euro in Vertrieb und Marketing erzielt wird.
Sales Efficiency = Umsatzwachstum ÷ Vertriebs- und Marketingkosten
Beispiel: Ein Unternehmen verzeichnet ein Umsatzwachstum von 200.000 € und hat dafür 100.000 € in Vertrieb und Marketing investiert.
Sales Efficiency = 200.000 € ÷ 100.000 € = 2
Ein Wert von 2 bedeutet, dass für jeden investierten Euro ein Umsatzwachstum von 2 € erzielt wurde. Je höher der Wert, desto effizienter sind die Vertriebs- und Marketingaktivitäten.
Magic Number
Die Magic Number ist eine Kennzahl, die speziell im SaaS-Bereich verwendet wird, um die Effizienz der Vertriebs- und Marketingausgaben im Verhältnis zum wiederkehrenden Umsatzwachstum zu messen.
Magic Number = (Quartalsweises Umsatzwachstum × 4) ÷ Vertriebs- und Marketingkosten des Vorquartals
Beispiel: Wenn das quartalsweise Umsatzwachstum 50.000 € beträgt und die Vertriebs- und Marketingkosten des Vorquartals 100.000 € waren:
Magic Number = (50.000 € × 4) ÷ 100.000 € = 2
Ein Wert über 1 deutet darauf hin, dass die Vertriebs- und Marketinginvestitionen zu effizientem Wachstum führen. Werte unter 0,5 könnten signalisieren, dass die Ausgaben überprüft werden sollten.
Personal-Kennzahlen (Headcount Metrics)
Personal-Kennzahlen helfen Unternehmen, die Produktivität und Effizienz ihrer Mitarbeiter zu messen und Personalstrategien zu optimieren.
Umsatz pro Mitarbeiter
Der Umsatz pro Mitarbeiter misst, wie viel Umsatz jeder Mitarbeiter im Durchschnitt generiert, und ist ein Indikator für die Produktivität der Belegschaft.
Umsatz pro Mitarbeiter = Gesamtumsatz ÷ Anzahl der Mitarbeiter
Beispiel: Ein Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 10.000.000 € und 50 Mitarbeitern hat:
Umsatz pro Mitarbeiter = 10.000.000 € ÷ 50 = 200.000 €
Branchenrichtwerte:
- SaaS/Technologieunternehmen: 200.000 € -- 400.000 €
- Dienstleistungen/Agenturen: 100.000 € -- 200.000 €
Ein Vergleich mit Branchenrichtwerten hilft, die eigene Position im Markt zu bewerten.
Personalgesamtkosten („Fully Burdened Labor“)
Die Personalgesamtkosten umfassen alle Kosten, die ein Unternehmen für einen Mitarbeiter aufwendet, einschließlich Gehälter, Sozialleistungen, Steuern und indirekter Kosten wie Ausbildung und Arbeitsplatzinfrastruktur.
Beispiel: Ein Mitarbeiter hat ein Bruttogehalt von 60.000 €. Hinzu kommen Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, betriebliche Altersvorsorge und weitere Leistungen in Höhe von 15.000 €. Indirekte Kosten betragen 5.000 €.
Personalgesamtkosten = 60.000 € + 15.000 € + 5.000 € = 80.000 €
Diese Kennzahl ist wichtig für die Projektkalkulation, Preisgestaltung und Budgetplanung.
Fluktuationsrate
Die Fluktuationsrate gibt an, wie viele Mitarbeiter ein Unternehmen innerhalb eines bestimmten Zeitraums verlassen haben, relativ zur durchschnittlichen Mitarbeiterzahl. Eine hohe Fluktuationsrate kann auf Probleme wie geringe Mitarbeiterzufriedenheit, schlechtes Arbeitsklima oder unzureichende Vergütung hinweisen.
Fluktuationsrate = (Anzahl der ausgeschiedenen Mitarbeiter ÷ Durchschnittliche Mitarbeiterzahl) × 100 %
Beispiel: In einem Jahr verlassen 8 Mitarbeiter ein Unternehmen mit durchschnittlich 80 Mitarbeitern.
Fluktuationsrate = (8 ÷ 80) × 100 % = 10 %
Unternehmen sollten die Gründe für Fluktuation analysieren und Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung ergreifen.
Auslastungsrate
Die Auslastungsrate misst, wie effektiv die Arbeitszeit der Mitarbeiter genutzt wird, insbesondere in projektbasierten Unternehmen oder Dienstleistungsbranchen.
Auslastungsrate = (Produktive Stunden ÷ Verfügbare Arbeitsstunden) × 100 %
Beispiel: Ein Berater hat in einem Monat 160 verfügbare Arbeitsstunden. Davon sind 120 Stunden fakturierbar an Kundenprojekten gearbeitet worden.
Auslastungsrate = (120 ÷ 160) × 100 % = 75 %
Eine hohe Auslastungsrate ist wünschenswert, da sie auf eine effiziente Nutzung der Ressourcen hinweist. Allerdings sollte auch auf Überlastung geachtet werden, um Burnout zu vermeiden.
Branchenspezifische KPIs mit anschaulichen Beispielen
E-Commerce
E-Commerce-Unternehmen nutzen eine Vielzahl von KPIs, um ihre Performance in verschiedenen Bereichen zu messen und zu optimieren.
Produktentdeckungsmetriken
- Impressions: Die Anzahl, wie oft ein Produkt auf der Website oder in Suchergebnissen angezeigt wird. Ein Unternehmen könnte beispielsweise feststellen, dass ein neues Produkt in der ersten Woche 10.000 Impressionen hatte.
- Reach: Die Anzahl der eindeutigen Nutzer, die ein Produkt gesehen haben. Wenn 5.000 verschiedene Personen das Produkt gesehen haben, wäre die Reichweite 5.000.
- Engagement: Misst, wie Nutzer mit einem Produkt interagieren (z.B. Klicks, Likes, Shares). Ein hohes Engagement deutet auf Interesse hin.
Akquisemetriken
- Email Click-Through Rate (CTR): Der Prozentsatz der Empfänger, die auf einen Link in einer Marketing-E-Mail klicken. Eine CTR von 5% bedeutet, dass 5 von 100 Empfängern geklickt haben.
- Cost per Acquisition (CPA): Die durchschnittlichen Kosten, um einen neuen Kunden zu gewinnen. Wenn ein Unternehmen 1.000 € für Werbung ausgibt und 100 neue Kunden gewinnt, beträgt der CPA 10 €. (CPA = Kosten / Anzahl neuer Kunden)
- Organischer Traffic: Besucher, die über unbezahlte Suchergebnisse oder direkte Links auf die Website gelangen. Ein hoher organischer Traffic zeigt eine gute SEO-Leistung und Markenbekanntheit.
- Social Media Engagement: Misst die Interaktionen (Likes, Kommentare, Shares) auf Social-Media-Posts. Hohes Engagement kann zu mehr Traffic und Conversions führen.
Konversionsmetriken
- Shopping Cart Abandonment Rate: Der Prozentsatz der Nutzer, die Produkte in den Warenkorb legen, aber den Kauf nicht abschließen. Eine hohe Abbruchrate kann auf Probleme im Checkout-Prozess hinweisen.
- Checkout-Abbruchrate: Ähnlich wie die Warenkorb-Abbruchrate, aber bezieht sich speziell auf Nutzer, die den Checkout-Prozess beginnen, aber nicht abschließen.
- Micro- zu Macro-Conversion Rates: Vergleicht kleinere Conversions (z.B. Newsletter-Anmeldung) mit größeren (z.B. Kauf). Hilft, den gesamten Conversion-Funnel zu optimieren.
- Durchschnittlicher Bestellwert (AOV): Der durchschnittliche Wert jeder Bestellung. Ein höherer AOV bedeutet mehr Umsatz pro Kunde. (AOV = Gesamtumsatz / Anzahl Bestellungen)
- Sales Conversion Rates: Der Prozentsatz der Website-Besucher, die einen Kauf tätigen. Eine Conversion Rate von 2% bedeutet, dass 2 von 100 Besuchern kaufen.
Retentionsmetriken
- Customer Retention Rate: Der Prozentsatz der Kunden, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg beim Unternehmen bleiben. Eine hohe Retention Rate zeigt Kundenzufriedenheit.
- Customer Lifetime Value (CLV): Der Gesamtwert, den ein Kunde während seiner gesamten Beziehung zum Unternehmen generiert.
- Wiederkaufrate: Der Prozentsatz der Kunden, die erneut kaufen. Eine hohe Wiederkaufrate zeigt, dass Kunden zufrieden sind und wiederkommen.
- Refund and Return Rate: Der Prozentsatz der Bestellungen, die zurückgegeben oder erstattet werden. Eine hohe Rate kann auf Produktqualität oder Kundenzufriedenheitsprobleme hinweisen.
- Ecommerce Churn Rate: Der Prozentsatz der Kunden, die in einem bestimmten Zeitraum abwandern. Eine niedrige Churn Rate ist wünschenswert.
Advocacy Metriken (Brand Reputation)
- Net Promoter Score (NPS): Misst die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden das Unternehmen weiterempfehlen. Ein hoher NPS zeigt eine starke Markenbindung.
- Subscription Rate: Der Prozentsatz der Kunden, die ein Abonnement abschließen. Eine hohe Rate zeigt wiederkehrende Einnahmen.
- Program Participation Rate: Misst die Teilnahme an Treueprogrammen oder anderen Initiativen. Hohe Teilnahme zeigt Kundenengagement.
Immobilien/Real Estate
- Net Operating Income (NOI): Das Nettobetriebsergebnis einer Immobilie, berechnet als Mieteinnahmen abzüglich Betriebskosten.
- Capitalization Rate (Cap Rate): Das Verhältnis von NOI zum Marktwert einer Immobilie. Eine hohe Cap Rate kann auf ein höheres Risiko oder eine niedrigere Nachfrage hinweisen. (Cap Rate = NOI / Marktwert)
- Gross Rent Multiplier (GRM): Das Verhältnis vom Kaufpreis einer Immobilie zu den jährlichen Bruttomieterträgen. Ein hoher GRM kann auf eine Überbewertung hinweisen. (GRM = Kaufpreis / Jährliche Bruttomieterträge)
- Return on Investment (ROI): Die Rendite einer Immobilieninvestition, berechnet als Gewinn im Verhältnis zur Investition. (ROI = (Gewinn aus Verkauf - Investitionskosten) / Investitionskosten)
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR): Misst die Fähigkeit einer Immobilie, Schulden zu bedienen. Ein DSCR über 1 zeigt, dass die Mieteinnahmen die Schuldenzahlungen decken können. (DSCR = NOI / Schuldendienst)
SaaS-Unternehmen
- Annual Recurring Revenue (ARR): Die jährlichen wiederkehrenden Einnahmen aus Abonnements.
- Churn Rate: Der Prozentsatz der Kunden, die ihr Abonnement in einem bestimmten Zeitraum kündigen.
- Customer Acquisition Cost (CAC): Die durchschnittlichen Kosten, um einen neuen Kunden zu gewinnen.
- Customer Lifetime Value (CLV): Der Gesamtwert, den ein Kunde während seiner gesamten Beziehung zum Unternehmen generiert.
- LTV zu CAC Verhältnis: Vergleicht CLV mit CAC, um die Rentabilität der Kundenakquise zu bewerten.
- Net Promoter Score (NPS): Misst die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden das Unternehmen weiterempfehlen.
- Magic Number: Misst die Effizienz der Vertriebs- und Marketingausgaben im Verhältnis zum Umsatzwachstum.
- Retention Costs: Die Kosten, die für die Kundenbindung aufgewendet werden.
- ARR pro CSM: Das Verhältnis von ARR zum Anzahl der Customer Success Manager.
Diese Beispiele zeigen, wie verschiedene Branchen spezifische KPIs verwenden, um ihren Erfolg zu messen und fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen. Es ist wichtig, die relevanten KPIs für die jeweilige Branche zu verstehen und zu verfolgen, um eine optimale Performance zu gewährleisten.
Kennzahlen im Controlling: Vor- und Nachteile
Vorteile von Kennzahlen
Kennzahlen können die Geschäftsführung bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Sie können -- richtig angewendet -- konkrete, faktenbasierte Informationen liefern. Komplexe Zusammenhänge können hierdurch verständlich analysiert werden. Mit Kennzahlen können sowohl Stärken als auch Schwächen in einem Betrieb ermittelt werden. Sie können bereits frühzeitig auf mögliche Krisen des Unternehmens hinweisen und werden daher beispielsweise vor allem in der Liquidiätsplanung häufig eingesetzt.
Kennzahlen können zudem eingesetzt werden, um zu prüfen, ob gesetzte Ziele erreicht wurden. Gerade für das Management liefern sie wichtige Informationen zur Unterstützung von Entscheidungen und der Frage, ob Maßnahmen zu ergreifen sind. Ist das Working Capital zum Beispiel außergewöhnlich hoch, lohnt sich ein Blick auf die Lagerbestände. Müssen Lagerbestände verringert werden?
Nachteile von Kennzahlen
Nachteile beim Einsatz von Kennzahlen entstehen vor allem, wenn das Bewusstsein und Verständnis fehlen. Eine Kennzahl kann nur zu Erkenntnissen führen, wenn sie auch richtig eingeordnet und interpretiert wird.
Wird beispielsweise die Gesamtkapitalrentabilität eines Unternehmens für das Jahr 2020 mit 9 % ermittelt, sagt das zunächst nicht viel aus. Erst im Vergleich mit anderen Kennzahlen ergibt sich ein Bild: Wie war die Gesamtrentabilität im Vorjahr? Welche Werte werden bei anderen Unternehmen aus der Branche erzielt? Eine einzelne Kennzahl hilft also in der Regel noch nicht weiter. Kennzahlen werden häufig vergangenheitsorientiert entwickelt -- gerade die zeitliche Einordnung spielt also ebenfalls eine große Rolle.
Zudem wird häufig kritisiert, dass Kennzahlen nur quantitative Informationen zusammenfassen. In Entscheidungen sind aber durchaus auch qualitative Faktoren (oft auch „weiche Faktoren“ genannt) zu berücksichtigen. Das kann zum Beispiel im Bereich der Kundenbindung sein. Wenn ein Vertriebsmitarbeiter außergewöhnlich empathisch ist, kann dies nur schlecht in Kennzahlen ausgedrückt werden.
Beispiel: Welche Kennzahlen das Controlling für die Produktion einsetzt
In produzierenden Unternehmen ist die Ressourcenplanung von besonders großer Bedeutung. Das Controlling setzt deshalb entsprechende Kennzahlen ein, gerade beispielsweise beim Einsatz von Mitarbeitern, Material und Maschinen. Zudem muss regelmäßig analysiert werden, wie es um die Produktivität steht. So kommen beispielsweise folgende Kennzahlen häufig zum Einsatz:
- Produktivität: Vereinfacht gesagt wird mit der Kennzahl Produktivität berechnet, wie das Verhältnis zwischen Output und Input ist. Das Unternehmen kann also ermitteln, wie viele Mittel es einsetzen muss, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Die Formel lautet also:
Produktivität = Output / Input
- Produktionsfehlerquote: Mit der Produktionsfehlerquote lassen sich Rückschlüsse zur Qualität der Produktionsprozesse schließen. Ist sie außergewöhnlich hoch, sollten Abläufe und mögliche Fehlerquellen genauer geprüft werden. Die Formel zur Berechnung lautet:
Produktionsfehlerquote = Fehlproduktionen (Stückzahl) / Gesamtstückzahl
- Overall Equipment Efficiency: Mit dieser Kennzahl wird die Gesamtanlageneffektivität ermittelt. Gibt es Produktionsverluste? Die Formel lautet:
Overall Equipment Efficiency = Verfügbarkeitsfaktor Effizienzfaktor Qualitätsfaktor
- Produktionskosten: Wer etwas produziert, will auch wissen, wie viele Kosten je Einheit entstehen. Das ist sowohl für die Ressourcenplanung eine wichtige Information als auch für die Preisfindung. Denn am Ende soll das Produkt mit Gewinn vertrieben werden. Die Formel lautet vereinfacht (im Detail sollten verschiedene Produktvarianten betrachtet werden):
Produktionskosten = Produktionskosten / Anzahl der Produkte
Kennzahlen im Controlling zum Thema Nachhaltigkeit etablieren
Nachhaltigkeit hat sich in vielen Unternehmen als wichtiges Thema etabliert. So werden beispielsweise nachhaltig produzierte Produkte auch als solche beworben. Und viele Unternehmen sind verpflichtet, in ihren Jahresabschlüssen über Nachhaltigkeitsthemen zu berichten. Wenn also Nachhaltigkeit ein Erfolgsfaktor wird, muss auch das Controlling genauer hinschauen und Kennzahlen entwickeln, wie zum Beispiel zu:
- CO2-Einsparungen
- Treibhausemmissionen
- Energie- und Wasserverbrauch
KPIs zur Exit-Strategie und Unternehmensbewertung
Bei der Planung eines Unternehmensverkaufs oder der Aufnahme von Investoren ist die Unternehmensbewertung von entscheidender Bedeutung. Dabei spielen verschiedene Bewertungskennzahlen eine zentrale Rolle, um den Wert des Unternehmens zu bestimmen und potenziellen Käufern oder Investoren eine Grundlage für Verhandlungen zu bieten.
EBITDA-Multiplikator
Der EBITDA-Multiplikator ist ein weit verbreiteter Maßstab für die Unternehmensbewertung. Er setzt das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Relation zum Unternehmenswert. Die Höhe des Multiplikators variiert je nach Branche und individuellen Faktoren des Unternehmens.
- E-Commerce: In der E-Commerce-Branche liegt der EBITDA-Multiplikator typischerweise zwischen 3x und 6x. Ein Unternehmen mit einem EBITDA von 1 Million Euro könnte also mit 3 bis 6 Millionen Euro bewertet werden.
- SaaS/Technologieunternehmen: SaaS- und Technologieunternehmen weisen aufgrund ihres hohen Wachstumspotenzials oft höhere EBITDA-Multiplikatoren auf, die zwischen 6x und 15x liegen können.
- Einzelhandel: Im Einzelhandel liegt der EBITDA-Multiplikator in der Regel zwischen 3x und 5x.
Umsatzmultiplikator
Der Umsatzmultiplikator wird häufig zur Bewertung von Start-ups oder Unternehmen ohne Gewinn eingesetzt. Er setzt den Unternehmenswert in Relation zum Umsatz.
Entry- und Exit-Multiples
Für Investoren sind Entry- und Exit-Multiples von großer Bedeutung. Der Entry-Multiple gibt an, zu welchem Vielfachen des EBITDA oder Umsatzes ein Investor in das Unternehmen einsteigt. Der Exit-Multiple hingegen zeigt, zu welchem Vielfachen der Investor das Unternehmen voraussichtlich verkaufen kann. Die Differenz zwischen Entry- und Exit-Multiple stellt den potenziellen Gewinn des Investors dar.
Economic Value Added (EVA)
Der Economic Value Added (EVA) misst den Wert, den ein Unternehmen über seine Kapitalkosten hinaus erwirtschaftet. Ein positiver EVA zeigt an, dass das Unternehmen Wert für seine Aktionäre schafft.
- Formel: EVA = NOPAT - (Kapitalkosten * Investiertes Kapital)
- NOPAT: Net Operating Profit After Taxes (Nettobetriebsergebnis nach Steuern)
- Kapitalkosten: Durchschnittliche Kosten des eingesetzten Kapitals
- Investiertes Kapital: Gesamtbetrag des im Unternehmen investierten Kapitals
Market Value Added (MVA)
Der Market Value Added (MVA) gibt die Differenz zwischen dem Marktwert des Unternehmens und dem investierten Kapital an. Ein positiver MVA bedeutet, dass das Unternehmen Wert für seine Aktionäre geschaffen hat.
- Formel: MVA = Marktwert des Unternehmens - Investiertes Kapital
Bewertungsmethoden für verschiedene Branchen
Die Wahl der geeigneten Bewertungsmethoden hängt stark von der Branche ab. Während beispielsweise in technologieorientierten Branchen das Wachstumspotenzial eine wichtige Rolle spielt, sind in traditionellen Branchen wie dem Einzelhandel eher Kennzahlen wie das EBITDA von Bedeutung. Es ist daher wichtig, branchenspezifische Besonderheiten bei der Unternehmensbewertung zu berücksichtigen.
Fazit: Die Unternehmensbewertung ist ein komplexer Prozess, der verschiedene Kennzahlen und Methoden umfasst. Eine sorgfältige Analyse dieser KPIs ermöglicht es Unternehmen, ihren Wert realistisch einzuschätzen und fundierte Entscheidungen bei Exit-Strategien oder der Aufnahme von Investoren zu treffen.
Im Controlling werden Kennzahlen in Excel berechnet
Viele Controller pflegen und berechnen Kennzahlen in Excel. Bei wenigen Kennzahlen kann dies auch recht simpel und mit überschaubarem Aufwand umgesetzt werden. So werden beispielsweise Liquiditätsplanungen oder Bilanzanalysen häufig in Excel erstellt. Viele Unternehmen interessieren sich jedoch bereits für moderne Tools, um manuelle Arbeiten an lokal gespeicherten Dateien zu minimieren.
Ob Planung oder Reporting: Automatisierung und Vernetzung werden hier für Unternehmen immer wichtiger.
Fehler im Controlling vermeiden
Fehler im Controlling können schwerwiegende Konsequenzen für ein Unternehmen haben. Es ist daher wichtig, dass Controller und Manager sich der möglichen Fehlerquellen bewusst sind und Maßnahmen ergreifen, um diese zu vermeiden.
Einige häufige Fehler im Controlling sind:
- Fehlende oder unvollständige Daten: Ohne vollständige und genaue Daten können keine fundierten Entscheidungen getroffen werden. Es ist daher wichtig, dass alle relevanten Daten erfasst und regelmäßig aktualisiert werden.
- Falsche oder ungenaue Daten: Fehlerhafte Daten können zu falschen Schlussfolgerungen und Entscheidungen führen. Eine regelmäßige Überprüfung und Validierung der Daten ist daher unerlässlich.
- Fehlende oder unzureichende Analyse: Eine oberflächliche Analyse der Daten kann dazu führen, dass wichtige Informationen übersehen werden. Es ist wichtig, dass die Daten gründlich analysiert und interpretiert werden.
- Fehlende oder unzureichende Kommunikation: Die Ergebnisse der Analyse müssen klar und transparent kommuniziert werden, damit alle relevanten Entscheidungsträger informiert sind und entsprechend handeln können.
Um diese Fehler zu vermeiden, ist es wichtig, dass Controller und Manager:
- Sich der Bedeutung von genauen und vollständigen Daten bewusst sind
- Regelmäßig die Daten überprüfen und aktualisieren
- Eine umfassende Analyse der Daten durchführen
- Die Ergebnisse der Analyse klar und transparent kommunizieren
Durch die Beachtung dieser Punkte können Fehler im Controlling minimiert und fundierte Entscheidungen getroffen werden.
Wie Kennzahlen Fehler im Controlling aufdecken können
Kennzahlen können dazu dienen, Fehler im Controlling aufzudecken und zu vermeiden. Durch die regelmäßige Überwachung von Kennzahlen können Controller und Manager:
- Abweichungen von den geplanten Zielen erkennen: Wenn die tatsächlichen Werte von den geplanten Zielen abweichen, können Kennzahlen helfen, diese Abweichungen frühzeitig zu erkennen und zu analysieren.
- Fehlentwicklungen frühzeitig erkennen und korrigieren: Kennzahlen können auf negative Trends oder Entwicklungen hinweisen, die korrigiert werden müssen, bevor sie zu größeren Problemen führen.
- Die Effizienz und Effektivität von Prozessen und Abläufen überwachen: Durch die Überwachung von Kennzahlen können ineffiziente Prozesse identifiziert und verbessert werden.
- Die Risiken von Fehlern und Abweichungen minimieren: Kennzahlen helfen, potenzielle Risiken zu identifizieren und Maßnahmen zu ergreifen, um diese zu minimieren.
Einige Beispiele für Kennzahlen, die dazu dienen können, Fehler im Controlling aufzudecken, sind:
- Umsatzrendite: Diese Kennzahl misst das Verhältnis von Umsatz zu Kosten und kann helfen, ineffiziente Kostenstrukturen zu identifizieren.
- Kapitalrentabilität: Diese Kennzahl misst das Verhältnis von Gewinn zu Kapital und kann auf ineffiziente Kapitalnutzung hinweisen.
- Eigenkapitalrentabilität: Diese Kennzahl misst das Verhältnis von Gewinn zu Eigenkapital und kann auf eine unzureichende Rentabilität des Eigenkapitals hinweisen.
- Return on Investment (ROI): Diese Kennzahl misst das Verhältnis von Gewinn zu Investitionen und kann helfen, die Rentabilität von Investitionen zu bewerten.
Durch die regelmäßige Überwachung und Analyse dieser Kennzahlen können Unternehmen Fehler im Controlling frühzeitig erkennen und Maßnahmen ergreifen, um diese zu korrigieren.
Wichtiges zu Kennzahlen kurz und knapp
Welche Kennzahlen sind am wichtigsten?
Unternehmen können wahre Massen an Kennzahlen ermitteln und sammeln. Doch welche Kennzahlen sind denn besonders wichtig? Hier gibt es keine Standardantwort. Für jedes Unternehmen können, je nach Geschäftstätigkeit, Branche und Größe, unterschiedliche Kennzahlen von großer Bedeutung sein. Es gibt jedoch bestimmte Kennzahlen, die besonders häufig zum Einsatz kommen (vgl. nachfolgend).
Was für Kennzahlen gibt es?
Es gibt zahlreiche Kennzahlen. Unterteilt werden können diese beispielsweise in absolute oder relative Kennzahlen.
Beispiele zu wirtschaftlichen Kennzahlen: Regelmäßig in der Praxis besonders bekannt sind:
- Umsatz,
- Verschuldungsgrad,
- Eigenkapitalrentabilität,
- Umsatzrentabilität,
- Eigenkapitalquote,
- Liquiditätskennzahlen, wie die Liquidität 1., 2. und 3. Grades.
Welche KPI gibt es?
KPI steht für Key Performance Indicator. Sie werden zwar häufig synonym zu Kennzahlen verwendet. Doch tatsächlich gibt es einen feinen Unterschied: KPIs messen den Erfolg eines Unternehmens. Wurden gesetzte Ziele erreicht? Beispielsweise im Bereich Kundenzufriedenheit.