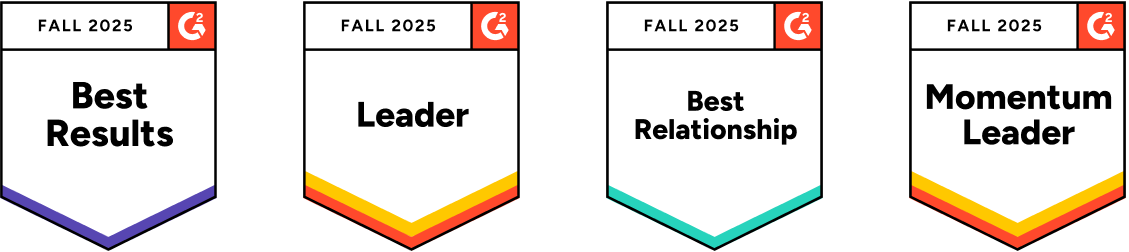Inhouse Banking: Was ist das und wie funktioniert es?


Bereits 1996 hat Beate Foerstner eine Diplomarbeit rund um das Thema der Inhouse Bank geschrieben – lange bevor die heutigen Möglichkeiten der Digitalisierung Inhouse Banking für Unternehmen deutlich vereinfacht haben. Doch was steckt eigentlich hinter der Praxis, das Cash Management mit einer „eigenen“ Bank zu vereinfachen? Wir erklären Ihnen alles rund um die Inhouse Bank und welche Vorteile sie bietet.
Definition: Was ist eine Inhouse Bank?
Eine Inhouse Bank, abgekürzt mit IHB, ist ein „internes Bankinstitut“ innerhalb eines Konzerns und übernimmt typische Bankdienstleistungen wie Kreditvergabe, Zahlungen und weitere Bestandteile des Cash Managements innerhalb des Unternehmens. Dabei kann die IHB eine eigene juristische Person oder Institution sein.
Im Rahmen des Inhouse Bankings werden also finanzielle Transaktionen zwischen verschiedenen Geschäftseinheiten eines Konzerns verwaltet und abgewickelt. Ziel hinter dieser Praxis – bereits seit den 1980er-Jahren angewandt und mit der zunehmenden Digitalisierung immer relevanter geworden – ist es, so die Effizienz diverser Finanzprozesse zu erhöhen und das Treasury Management auf oberster Ebene zu vereinfachen. Ein Beispiel könnte die interne Kreditvergabe (Intercompany-Loan) sein – die Abwicklung über ein externes Bankinstitut wäre deutlich komplizierter.

Eine Inhouse Bank, oft auch als Nichtbank (Non-Bank) bezeichnet, tritt in der Regel nicht mit externen Kund:innen in Kontakt, sondern dient ausschließlich der internen Finanzorganisation und -optimierung.
Welche Funktionen bringt eine Inhouse Bank mit sich?
Die Funktionen einer Inhouse Bank drehen sich immer rund um ein zentralisiertes Finanzmanagement. Foerstner bringt in ihrer Arbeit auf den Punkt, dass beim Inhouse Banking Bankbeziehungen auf ein notwendiges Minimum reduziert werden sollen: „Das In-House-Banking zielt letztlich auf [...] die weitestgehende Integration der diesen Beziehungen zugrundeliegenden Geschäfte in das eigene Finanzmanagement ab.“
Damit das gelingt, muss oder sollte eine IHB folgende Aspekte und Prozesse aus dem Cash Management und Treasury abdecken:
- Intercompany-Finanzierung: Verbundene Unternehmen innerhalb des Konzerns können von der Inhouse Bank Kredite beziehen. Das ist beispielsweise bei hohen Finanzierungskosten eine Option – und in den meisten Fällen deutlich einfacher in der Abwicklung.
- Cash Management: Eine Inhouse Bank koordiniert und konsolidiert die Liquidität verschiedener Unternehmenseinheiten (beispielsweise sämtlicher Tochtergesellschaften) für mehr Effizienz im Bereich Treasury und zur Kostenminimierung.
- Risikomanagement: Ist die Finanzinfrastruktur durch die IHB zentralisiert, ermöglicht das dem Treasury eine bessere Kontrolle über alle Daten und Zugriffsrechte. Zudem sinkt das Risiko von Betrugsattacken durch die gesunkene Anzahl an Bankkonten und Schnittstellen. Auch das Währungsrisiko (FX-Risiko) und Zinsrisiko wird durch FX-Hedging und Zinsabsicherung gesenkt.
- Netting und Cash Pooling: Inhouse Banking ermöglicht die Verrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen verschiedenen Konzerngesellschaften (Netting) und optimiert die Liquiditätssteuerung durch Zusammenführung von Salden mehrerer Konten (Cash Pooling). So können interne Ressourcen besser genutzt werden und Finanzierungen werden womöglich gar nicht erst nötig.
- Payment Hub: Als zentrale Anlaufstelle für alle Transaktionen eines Gesamtunternehmens erleichtert die IHB die Prozessstandardisierung und -automatisierung sämtlicher Zahlungsströme – das gilt sowohl für Zahlungseingänge (Collections) als auch -ausgänge (Payments).
- Cash Visibility: Indem alle Bankkonten an die Inhouse Bank angebunden werden, steigt die Cash Visibility – das sorgt für einen verbesserten Überblick über die Liquidität und ist Grundlage für bessere kurz- und langfristige Finanzentscheidungen.
Ist eine Inhouse Bank sinnvoll?
Die Antwort auf diese Frage lässt sich mit einem klaren Ja beantworten. Sicher: Nicht in allen Unternehmen rechtfertigt der Aufwand der Implementierung einer Inhouse-Banking-Lösung den Ertrag. Gerade für große, international tätige Konzerne mit vielen angeschlossenen Gesellschaften und vielen Zahlungsströmen ist eine Inhouse Bank in jedem Falle sinnvoll. Wir stellen Ihnen die Vorteile später ausführlich vor.
Davor gehen wir auf die Unterschiede zu virtuellen Bankkonten und Cash Pooling ein. Beides sind oft genannte Alternativen zu Inhouse Banking.
Inhouse Banking vs. virtuelle Bankkonten
Virtuelle Bankkonten bieten eine gute Möglichkeit zur Verwaltung der Intercompany-Buchführung und unterstützen dabei diverse grundlegende Zahlungs- und Sammelvorgänge. Das Problem daran: Sie sind stark von den Bankstrukturen abhängig und weniger flexibel im Vergleich zu einer Inhouse Bank.
Solche virtuellen Konten eignen sich im Finanzmanagement daher ideal für kleinere Unternehmen mit wenig Bankkonten, die eine einfache Lösung für die Zentralisierung des Cash Managements suchen. Bei größerem Wachstum – vor allem international – stoßen sie jedoch schnell an ihre Grenzen. Im Gegensatz dazu ermöglicht eine IHB wie beschrieben eine umfassende(re) Steuerung von Finanzströmen und Risiken und bietet größere Skalierbarkeit und Flexibilität.
Inhouse Banking vs. Cash Pooling
Cash Pooling ist wie jedes virtuelle Konto auch von den Banken abhängig. Mit der bewährten Methode können Unternehmen ihre Liquidität durch das Ausgleichen der Salden von Tochtergesellschaften optimieren – das führt zu reduzierten Bankgebühren und einer verbesserten Kontrolle über die Konzernliquidität.
Eine IHB bietet allerdings deutlich mehr Funktionen, die über das bloße Cash Management hinausgehen. Sie ist daher deutlich strategischer als Cash Pooling oder auch virtuelle Bankkonten.
Vorteile von Inhouse Banking
Zentrale Kontrolle
Der wohl größte Vorteil von Inhouse Banking liegt in seinem übergeordneten Ziel, der zentralisierten Kontrolle über globale Zahlungen, Finanzierungen und Investitionen. Das wiederum bildet die Grundlage für andere Vorteile wie die Senkung der Kosten für Fremdwährungs- und Auslandszahlungsgebühren oder das verminderte FX-Risiko auf Konzernebene.
Verbessertes Liquiditätsmanagement
Durch die zentrale Verwaltung von Cashflows bietet Inhouse Banking eine verbesserte Sichtbarkeit und Kontrolle über die Liquidität. Finanzielle Mittel können so zielgerichteter allokiert werden – das unterstützt eine präzisere Cashflow-Prognose und Finanzplanung.
Im folgenden Video erfahren Sie, welche Vorteile es bringt, wenn Sie ein Treasury-Management-Tool wie Agicap zur Zusammenführung der Liquidität Ihrer gesamten Unternehmensgruppe einsetzen:
Mehr finanzielle Flexibilität
Inhouse Banking reduziert die Abhängigkeit von externen Banken und Finanzdienstleistern, indem es interne Finanzierungsmöglichkeiten wie Darlehen zwischen Tochtergesellschaften ermöglicht. Diese Flexibilität kann besonders in Krisenzeiten von Vorteil sein, wenn der Zugang zu externen Finanzmärkten eingeschränkt oder teuer ist.
Zudem ist diese Art des Bankings deutlich günstiger, da externe Bankgebühren weitgehend eliminiert werden – auch Transaktionsgebühren sinken beim IHB, da die Abwicklung der Zahlungen intern erfolgt.
Besseres Risikomanagement
Die zentrale Steuerung des FX- und Zinsrisikos innerhalb einer Inhouse Bank ermöglicht ein deutlich verbessertes Risikomanagement. Unternehmen können Wechselkurs- und Zinsänderungsrisiken effektiver steuern und so potenzielle Verluste minimieren.
Effizienzsteigerung
Automatischer Zahlungsabgleich und verbesserte Monatsabschlussprozesse erhöhen die Effizienz im Treasury. Mit einer Inhouse Bank werden Zahlungsprozesse für interne und externe Transaktionen erleichtert, was den administrativen Aufwand verringert – und damit letztlich auch Kosten spart.
Technologischer Fortschritt bringt noch mehr Vorteile
Neben diesen Vorteilen, kann die fortschreitende Technologisierung der Finanzwelt weitere Vorteile bringen, wie KPMG berichtet.
Die Integration moderner Technologien wie Robotic Process Automation und die Nutzung von Blockchain für internen Zahlungsausgleich revolutionieren laut der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Zahlungsverkehr- und Liquiditätsmanagementprozesse in einer Inhouse Bank, was zu einer weiteren Effizienzsteigerung führt. Die Marktreife dieser Technologien ist allerdings noch gering.
Wie ist eine Inhouse Bank rechtlich strukturiert?
Die rechtliche Struktur einer Inhouse Bank ist von zentraler Bedeutung, um sämtliche (internationale) Finanzvorschriften einzuhalten. Typischerweise verkörpert die Inhouse Bank eine eigenständige Einheit (etwa als eigenständige oder mit dem Mutterkonzern identische juristische Person) innerhalb des Konzerns, die speziell für das Treasury- und Finanzmanagement verantwortlich ist.
Diese Struktur ermöglicht eine klare Trennung von operativen Geschäftseinheiten und finanzieller Verwaltung.
- Rechtliche Autonomie: Die Inhouse Bank operiert unter eigener rechtlicher Identität, was die Haftung der Muttergesellschaft reduziert und regulatorische Anforderungen erfüllt.
- Compliance und Kontrollsysteme: Sie muss strenge interne Kontrollsysteme und Compliance-Mechanismen implementieren, um den gesetzlichen Anforderungen in verschiedenen Jurisdiktionen gerecht zu werden – dazu zählen etwa Anti-Geldwäsche-Richtlinien und KYC-Prüfungen (Know Your Customer).
- Verträge und Intercompany-Vereinbarungen: Es werden detaillierte Verträge zwischen der IHB und den anderen Konzerngesellschaften ausgehandelt, die die Bedingungen für Intercompany-Verrechnungen wie interne Kredite, Zahlungen und andere Finanzdienstleistungen regeln.
Beispiel für die Funktionsweise einer Inhouse Bank
Zum besseren Verständnis der Funktionsweise von Inhouse Banking machen wir ein Beispiel. Angenommen, Sie sind konzernverantwortlich und haben eine Tochtergesellschaft in Deutschland, die eine Finanzierung für eine neue Produktionsstätte benötigt.
Einer der üblichsten Wege im Finanzierungsmanagement wäre die Aufnahme eines externen Kredits. Da die Konditionen derzeit nicht attraktiv sind und der Antragsprozess langwierig ist, entscheiden Sie sich für eine Intercompany-Finanzierung. Statt eines externen Kredits erhält die Tochter von der Inhouse Bank des Konzerns – den Treasury-Mitarbeiter:innen liegen alle relevanten Informationen in Echtzeit vor – einen internen Kredit von fünf Millionen Euro zu einem günstigeren Zinssatz als am Markt.
Dieser interne Kredit wird zentral überwacht und kann natürlich deutlich flexibler gestaltet werden als das übliche Bankdarlehen.
👉 Lesen Sie auch mehr zum Thema Payment Factory in diesem Artikel!
Inhouse Bank als Teil eines Treasury-Management-Tools
Die Funktionen einer Inhouse Bank werden oft von Treasury-Management-Tools abgebildet. Dazu zählen dann die erwähnten Features wie Intercompany-Loans, Cash Pooling, Risikomanagement, aber auch POBO- und COBO-Vereinbarungen.
Moderne Treasury-Management-Systeme wie Agicap decken verschiedene Aspekte des Cash Managements ab, die für die Implementierung einer IHB entscheidend sind.
Beispielsweise ermöglicht die Zusammenführung sämtlicher Bankkonten über Agicap – idealerweise über eine Bank-ERP-Anbindung – eine zentrale Sicht auf alle Bankkonten und Zahlungsströme, was einer der Grundsteine des Inhouse Bankings ist.
Einige ausgewählte weitere Funktionen von Agicap für ein verbessertes Cash Management im Schnellüberblick:
- Kurzfristige Prognosen: Integration von allen erwarteten Transaktionen aus ERP- und Buchhaltungstools auf einer Oberfläche für aussagekräftige Cashflow-Prognosen
- Zahlungsabgleich: Genauere kurzfristige Prognosen dank Kontenabstimmung und Zahlungsabgleich bereits getätigter Transaktionen
- Cash Positioning: Visualisierung aller Bankguthaben
- Cash Pooling: Pooling aller Bankkonten inklusive automatischer Vorschläge, um Liquiditätsengpässe automatisch zu decken und freie liquide Mittel für Investitionen verfügbar zu machen
Diese Funktionen bilden die Basis für ein umfassendes Cash Management und eröffnen die Möglichkeit, zukünftig spezifischere Inhouse-Banking-Funktionen nahtlos zu integrieren. Dadurch bietet Agicap gerade für größere Unternehmen mit mehreren Banken und Tochtergesellschaften eine sinnvolle Plattform, die der Konzernebene ermöglicht, ihre Finanzen zentral besser zu steuern.
Fazit: Effizientes Cash Management für große Unternehmen durch Inhouse Banking
Die Inhouse Bank bietet insbesondere für größere, gerade international tätige Unternehmen signifikante Effizienzvorteile im Bereich Cash Management. Durch die zentralisierte Steuerung finanzieller Ströme und Risiken verbessert sie nicht nur die Entscheidungsfindung in der strategischen Planung im Hinblick auf Investitionsentscheidungen & Co., sondern kann auch im täglichen Geschäft eine spürbare Verbesserung darstellen.
Allerdings ist die Implementierung oft komplex, da unter anderem rechtliche Vorschriften verschiedener Länder berücksichtigt werden müssen – falls der Konzern international tätig ist. Als Faustregel gilt: Je internationaler und je mehr Banken beteiligt sind, desto komplizierter das Implementierungsprojekt.
Cloud-basierte Lösungen schaffen hier jedoch bereits eine gute Grundlage, da diese neben der zentralen Infrastruktur auch viele verschiedene Grundfunktionalitäten bereits bereitstellen.
Mit Cloud-basierten Treasury-Management-Tools wie Agicap verbessern Konzerne so nicht nur ihre Liquiditätsübersicht, wickeln Zahlungen zentral ab und binden sämtliche Banken an, sondern können durch weitere Inhouse-Banking-Features wie Intercompany-Loans und FX-Risikomanagement (beide Funktionen sind bei Agicap aktuell in der Entwicklung) zusätzliche positive Effekte erzielen.
Diese modernen Lösungen ermöglichen eine flexiblere und kosteneffiziente Verwaltung von Finanzprozessen. Haben Sie Interesse daran, Agicap und seine vielfältigen Features zu testen? Starten Sie noch heute Ihre unverbindliche Testphase!
FAQ: Meistgestellte Fragen zur Inhouse Bank (IHB)
Für wen lohnt sich eine Inhouse Bank?
Eine Inhouse Bank (IHB) lohnt sich vor allem für größere, international operierende Unternehmen, die eine Vielzahl von Transaktionen über verschiedene Währungen und geografische Standorte hinweg verwalten. Sie erhalten auf Konzernebene so effiziente Lösungen für das Cash Management, Risikomanagement und die Optimierung von Finanzprozessen, die unabhängig von externen Bankinstituten sind.
Was sind POBO?
POBO steht für „Payments On Behalf Of“. Bei dieser Methode tätigt eine zentrale Einheit (zum Beispiel eine Inhouse Bank) Zahlungen im Namen verschiedener Unternehmenseinheiten. Das macht eine zentralisierte Zahlungsabwicklung möglich, was wiederum Transaktionskosten reduziert.
Was sind COBO?
COBO steht für „Collections On Behalf Of“ und ist ein Pendant zu POBO. Hierbei sammelt die zentrale Einheit, etwa eine Inhouse Bank, Zahlungen für verschiedene angeschlossene Unternehmensbereiche. Das erleichtert die Liquiditätsverwaltung, da alle eingehenden Zahlungen zentral erfasst und verwaltet werden.